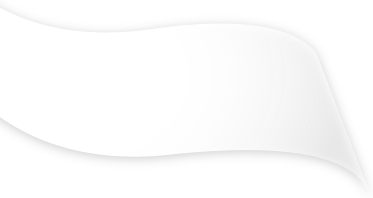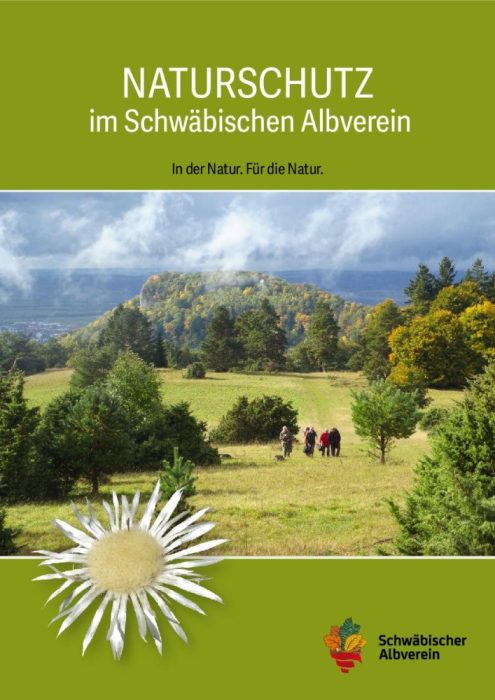Bis 30. April können sich ehrenamtliche Naturschützerinnen und Naturschützer sowie Vereine und Gruppen für den diesjährigen Kulturlandschaftspreis sowie für Fördermittel der LNV-Stiftung bewerben. Herzliche Einladung an alle Albvereins-Ortsgruppen, diese Möglichkeiten zu nutzen.
Kulturlandschaftspreis 2025
Seit 1991 verleiht der Schwäbische Heimatbund den Kulturlandschaftspreis. Seit 1995 wird er in Zusammenarbeit mit der Sparkassen-Finanzgruppe Baden-Württemberg vergeben. Es gibt Preisgelder von bis zu 10.500 Euro zu gewinnen. Damit fördern die Initiatoren Verdienste um die Erhaltung, Pflege und Wiederherstellung von Kulturlandschaften.
Albvereins-Ortsgruppen unter den Preisträgern
In den vergangenen Jahren sind immer wieder Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins mit dem Kulturlandschaftspreis ausgezeichnet worden. Etwa die OG Bonlanden für die Pflege der Wacholderheide Haberschlai, die OG Kohlberg/Kappishäusern für die Haltung von Ziegen zur Pflege von Magerrasen an Jusi und Florian oder die OG Sontheim/Brenz für den Erhalt von Streuobstwiesen und Hecken. Eine Bewerbung lohnt sich also.
Jugend-Kulturlandschaftspreis und Sonderpreis Kleindenkmale
Ergänzt wird der Kulturlandschaftspreis mit dem Jugend-Kulturlandschaftspreis, der mit 1.500 Euro dotiert ist. Das Preisgeld stellen der Sparkassenverband Baden-Württemberg sowie die Sparkassenstiftung Umweltschutz zur Verfügung.
Ein zusätzlicher Sonderpreis Kleindenkmale würdigt die Dokumentation, Sicherung und Restaurierung von Kleindenkmalen. Dazu können Gedenksteine, steinerne Ruhebänke, Feld- und Wegekreuze, Bachbrücken, Trockenmauern sowie Wegweiser oder Feldunterstände gehören.
Annahmeschluss für ausschließlich schriftliche Bewerbungen im Format DIN A4 ist der 30. April 2025. Alle Infos zum Kulturlandschaftspreis sind unter www.kulturlandschaftspreis.de abrufbar. Die Verleihung findet im Herbst 2025 im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung statt.
LNV-Stiftung fördert Naturschutzprojekte
Die Stiftung des Landesnaturschutzverbands Baden-Württemberg unterstützt im Jahr 2025 im Schwerpunkt Projekte rund um den Themenkreis Wasser und Gewässer, schließt aber auch Förderungen von Naturschutzinitiativen mit anderem Fokus nicht aus. Aufgerufen sind bevorzugt Vereine und Gruppen, die sich ehrenamtlich im Natur- und Umweltschutz engagieren. Die durchschnittliche Förderhöhe liegt bei etwa 1.500 Euro pro Projekt.
In den vergangenen Jahren haben Ortsgruppen des Schwäbischen Albvereins verschiedentlich Gelder von der LNV-Stiftung erhalten, etwa für den Erhalt von Streuobstwiesen. Auch hier lohnt sich eine Bewerbung also!
Antragsfrist ist der 30. April 2025. Alle Informationen und ein Antragsformular finden sich unter www.lnv-stiftung.de.
Liebe Ortsgruppen, nehmt diese Möglichkeiten wahr, Gelder für Eure Naturschutzarbeit einzuwerben sowie Eure Arbeit in der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Wenn Ihr Unterstützung bei der Antragsstellung braucht, dann stehen unsere Naturschutzreferentinnen gerne mit Rat und Tat zu Seite unter naturschutz@schwaebischer-albverein.de.