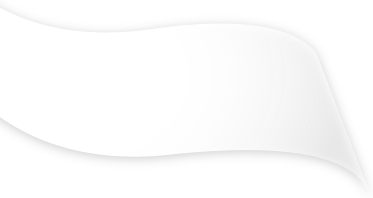Viele Ortsgruppen des Schwäbischen Albvereins waren in den vergangenen Wochen sehr mit dem Naturschutz beschäftigt. Denn gerade im Herbst gibt es viel zu tun mit der Pflege von Naturschutzgebieten und wertvollen Kulturlandschaften. Außerdem gab es einen großen Pflegeeinsatz des Gesamtvereins in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzzentrum Schwäbische Alb.
Landschaftspflegetag am Randecker Maar
Knapp 80 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer krempelten am Samstag, 19. Oktober, die Ärmel hoch, um das Naturschutzgebiet Randecker Maar von Ästen und Gebüsch zu befreien. Begrüßt wurden dabei vom Landrat des Landkreises Esslingen, Marcel Musolf, und der Vizepräsidentin des Schwäbischen Albvereins, Regine Erb.
Die Arbeit im steilen Gelände am Randecker Maar ist nicht einfach. Viele Male stiegen die Ehrenamtlichen den Hang hoch und wieder runter, schleppten dabei armweise Äste oder zogen veritable Stämme hinter sich her. Bergsteigen intensiv! Der Landschaftspflegetrupp des Schwäbischen Albvereins hatte schon in den Tagen zuvor intensiv gesägt und gemäht, so dass sich die Helfenden nicht über Arbeit beklagen konnten.
Doch warum ist es so wichtig, den Gehölzaufwuchs in dem Naturschutzgebiet zu entfernen? Dr. Susanne Bonn vom Referat Naturschutz und Landschaftspflege des zuständigen Regierungspräsidiums Stuttgart berichtete den Helferinnen und Helfer von den seltenen Arten, die im Randecker Maar heimisch sind. Etwa der Kleine Heidegrashüpfer, der sehr stark gefährdet ist und nur noch wenige Lebensräume hat. Oder den Gebirgsgrashüpfer, der auch im Maar lebt. Sie bräuchten offene Bodenstellen für ihre Eiablage, erklärte Bonn. Deshalb sei es sehr wichtig, Gebüsch zu entfernen, damit die Flächen offenbleiben. Erreicht wird das durch mechanische Landschaftspflege und unterjährige Schafbeweidung. Das Regierungspräsidium Stuttgart finanzierte den Pflegeeinsatz sowie die Verpflegung der Helfenden.
Herzlichen Dank an alle Helferinnen und Helfer sowie an das Kochteam der Ziegelhütte für das leckere Essen.
Pflegeeinsätze von Ortsgruppen – hier einige Beispiele
Harreser Erdfälle (OG Neuhausen ob Eck)
16 Helferinnen und Helfer haben auch dieses Jahr wieder die Harreser Erdfälle zu pflegen. Dabei handelt es sich um eine der wenigen noch aktiven Dolinen in Süddeutschland. Das Naturdenkmal ist Lebensraum seltener Pflanzen- und Tierarten. Die Ehrenamtlichen mähten große Teile der geschützten Fläche und transportierten das Mähgut ab. Die Pflegeaktion ist seit Jahrzehnten fester Bestandteil im Jahreskalender der Ortsgruppe.
Hecken- und Rainpflege in der Gemarkung Wurmlingen (OG Wurmlingen)
Den Lebensraum für Vögel und kleine Tiere zu schützen zu erhalten – das hat sich die OG Wurmlingen zum Ziel gesetzt. Dafür pflegt die Ortsgruppe regelmäßig Hecken in ihrer Gemarkung. Artfremdes Gebüsch wird entfernt, die Hecken zurückgeschnitten, so dass sich die Natur wieder entwickeln kann. Mit dabei war bei der diesjährigen Pflegeaktion die 8. Klasse der Konzenbergschule Außerdem wurde die Ortsgruppe von den Mitarbeitenden des Bauhofs der Gemeinde unterstützt.
Breitfeld (OG Willmandingen)
Die Ortsgruppe Willmandingen hat zusammen mit dem Sportverein und vielen weiteren Helfenden die Schwarzdorn-Stockausschläge im Gewann Breitfeld und Dieckes Wäldle entfernt. Es ist durchaus eine Herausforderung, den steilen Magerhang zu bearbeiten.
Wernauer Lehmgrube (Esslinger Gau)
Freiwillige aus fünf Ortsgruppen im Esslinger Gau trafen sich zu einem gemeinsamen Pflegeeinsatz in der Wernauer Lehmgrube. Gut ausstaffiert mit Rechen, Astscheren und Hacken sowie schwererem Gerät wie einer Motorsäge und einem Freischneider ging es auf die artenreiche Fläche. Die invasive Goldrute musste entfernt werden sowie Weidenruten zurückgeschnitten werden. Vor allem Wasserinsekten leben im und nahe des Weihers in der Lehmgrube wie Libellen oder der Kolbenwasserkäfer, Molche, Frösche und Kröten.
Herzlichen Dank an die Ehrenamtlichen im Naturschutz in allen Ortsgruppen sowie alle Helfenden, die sich jedes Jahr im gesamten Vereinsgebiet wieder engagieren, um wertvolle Naturflächen zu erhalten!