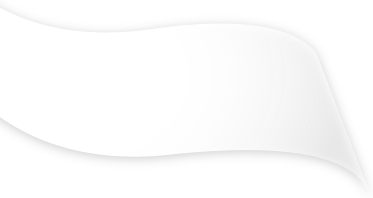Was haben Giersch, Löwenzahn und Brennnesseln gemeinsam? Sie wachsen oft da, wo sie nicht so gern gesehen sind und ärgern so den ordentlichen Gartenliebhaber. Um zu ihrer Rehabilitation beizutragen, gibt es seit einigen Jahren den Ehrentag des Unkrauts am 28. März.

Ausgerissen, vergiftet und als Un-Kraut verleumdet – Manche Pflanzen haben es nicht leicht. Dabei haben „Unkräuter“ wichtige Funktionen in der Natur. Sie ernähren Insekten und verknüpfen Arten- und Ökosysteme. Es sind Wildkräuter, Gräser und Wildblumen, die als begleitende Vegetation auf Äckern oder anderen Kulturpflanzenbeständen, Grünland oder in Gärten wachsen. Sie werden dort nicht gezielt angebaut, sondern säen sich selber aus.
Der Mensch stört sich oft an diesen Pflanzen. Trotz ihres ökologischen Wertes. Manche mögen eben keine Gänseblümchen oder Pusteblumen in ihrem Rasen. Andere ärgern sich, weil der Giersch das Gemüsebeet überwuchert. Landwirte bekämpfen etwa die Ackerwinde oder die Vogelmiere im Getreide, denn zu viel Unkraut mindert den Ertrag.

Ökologischer Wert sogenannter Unkräuter
Doch angesichts des massiven Artensterbens setzt auch ein Umdenken ein. Sogenannte Unkräuter bieten ernähren nämlich viele Bestäuber, sie sind Wohnstatt für viele Insekten oder schützen den Boden vor Erosion. Sie tragen dazu bei, unsere Ökosysteme stabiler und diverser zu machen und damit auch widerstandsfähiger gegen den Klimawandel. Gerade in dicht besiedelten Gebieten oder auf in landwirtschaftlichen Monokulturen bieten Äcker- oder Straßenränder mit Wildpflanzen Insekten ein Überleben. Und wer gerne Schmetterlinge oder andere Insekten in seinem Garten bewundert möchte, sollte dort einige „wilde Ecken“ stehen lassen als Brutstätte für Raupen und Insektenlarven und Nahrung für die ausgewachsenen Insekten.

Sieht gut aus, schmeckt gut und hilft gegen Wehwehchen
Dazu kommt, dass viele sogenannte Unkräuter einfach hübsch sind. Was symbolisiert denn den Sommer besser als das Rot des Klatschmohns oder das Blau der Kornblume? Kamille und Spitzwegerich sind mittlerweile als Heilpflanzen wieder fest etabliert, während Rübe oder Feldsalat – früher verpönt – mittlerweile als Kulturpflanzen gelten.

Dem Giersch an den Kragen
Doch was tun, wenn das „Unkraut“ wirklich stört und einfach nicht vergehen will – so wie etwa der Giersch im Garten? Der verbreitet sich im Sommer schneller, als man schauen kann. Durch seine unterirdischen Ausläufer ist er kaum in den Griff zu kriegen. Oberirdisch wächst er „wie Unkraut“ und nimmt anderen Pflanzen das Licht und den Platz. Alles in allem recht ärgerlich.
Doch warum nicht aus der Not eine Tugend machen und den lästigen Burschen einfach verspeisen? Mit Essig, Öl, Salz und Pfeffer angerichtet ergeben junge Triebe einen sehr leckeren, frischen Salat. Der Geruch und Geschmack des Gierschs etwas an Möhre oder Petersilie. Zudem ist er gesund. Als Heilpflanze soll er gegen Rheuma, Gicht, Ischias und viele weitere Zipperlein wirken, weswegen wird er in manchen Gegenden „Zipperleinskraut“ genannt wird.

Wilde Superfoods
Es gibt auch noch viele weiter vermeintliche Unkräuter, die wir vervespern können oder die gegen irgendwelche Wehwehchen helfen. Hier weitere Beispiele:
- Junger Löwenzahn zum Beispiel eignet sich wie der Giersch als Salat. Er enthält Vitamin A, Kalium und Bitterstoffe, die die Verdauung anregen. Geben wir noch ein paar Gänseblümchenblüten darüber, dann kommt noch eine Dosis Vitamin C dazu. Ein wahrer Super-Salat.
- Frische Brennnesseltriebe kann man kochen wie Spinat und bekommt neben dem würzigen Geschmack noch eine Extraportion Eisen, Kalzium und Magnesium dazu.
- Die Vogelmiere, ebenfalls reich an Eisen und Vitamin C, schmeckt gut als Pesto zubereitet.
- Die Blätter des Sauerampfers wirken antientzündlich, enthalten viel Vitamin C und eignen sich für Suppen, Soßen oder Salate. Doch bitte nur die ganz jungen, grünen Blätter pflücken und in Maßen genießen. Sauerampfer enthält nämlich Oxalsäure, die in größeren Mengen gesundheitsschädlich ist.
- Spitzwegerich lässt sich zu Hustentee verarbeitet. Der Saft aus zerriebenen Blättern lindert den Juckreiz bei Insektenstichen und fördert die Wundheilung.
Wenn Sie mehr wissen wollen, über Wildkräuter und wie sie sich in der Küche und Hausapotheke verwenden lassen, dann schauen Sie doch in unserem Lädle vorbei. Dort haben wir eine Auswahl Wildkräuter-Buchern für Sie vorrätig. Oder Sie stöbern in unserem Onlineshop.