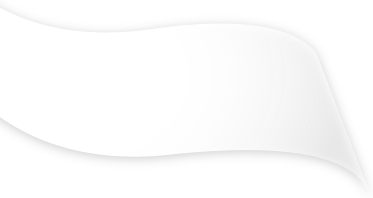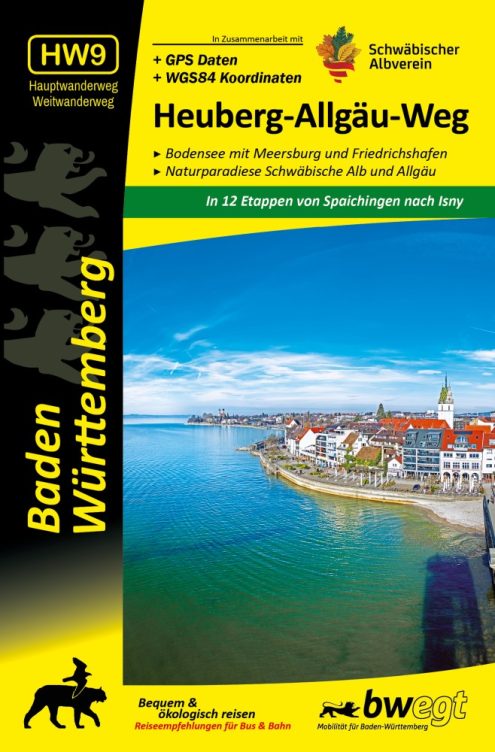Am Ende war man sich nicht einig, wer das gute Wetter geschickt hatte zur Hauptversammlung des Schwäbischen Albvereins am Sonntag, 14. Juli, in Wernau. Waren es die vielen Wandernden, die an den geführten Touren der Ortsgruppe teilnahmen? Oder doch die Stadt Wernau selbst mit ihrer gastfreundlichen Bürgermeisterin Christiane Krieger? Oder die Tatsache, dass Minister Peter Hauk und Landrat Heinz Eininger ihr Kommen zugesagt hatten? Die Halle im Quadrium war in jedem Fall gut mit Albvereinsmitgliedern gefüllt.

Grußworte mit Anerkennung und vielen guten Wünschen
Landrat Heinz Eininger und Bürgermeisterin Christiane Krieger dankten dem Schwäbischen Albverein in ihren Grußworten für die gute Zusammenarbeit und für den Beitrag des Vereins zum Gemeinwesen. „Niemand verbindet Wandern und Freizeit mit Natur und Landschaftsschutz wie der Schwäbische Albverein“, erklärte Eininger. Er berichtete von der Neubeschilderung der Wanderwege im Biosphärengebiet Schwäbische Alb, bei dem der Verein intensiv mitgearbeitet hat. Das Wegenetz sei sehr wichtig für die Attraktivität der Region, aber auch für den Landschaftsschutz, sagte Eininger und dankte allen Beteiligten.
„Wandern erfüllt unsere Sehnsucht nach Freiheit, danach eigene Wege zu gehen und dem Alltag zu entfliehen“, betonte Bürgermeisterin Christiane Krieger. In unruhigen Zeiten sei es wichtiger denn je, diese Kraft des Wanderns zu nutzen. Sie freue sich, dass es dem Albverein gelinge, so viele Menschen für das Wandern zu begeistern. Krieger dankte der OG Wernau für die Pflege der Wernauer Lehmgrube, eines wichtigen Naturschutzgebiets im Stadtgebiet.
Festvortrag zum Thema Wald und Landschaft im Klimawandel

Den Festvortrag hielt der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk. Er ging vor allem auf die Herausforderungen ein, die der Klimawandel für die Kulturlandschaften in Baden-Württemberg bedeutet. „Wälder, Wiesen und Felder werden sich gravierend verändern“, betonte Hauk. In der Landwirtschaft suche man deshalb nach Getreiden und anderen Ackerfrüchten, die Hitze gut aushalten. Im Taubergrund werden zum Beispiel Kichererbsen angebaut, eine Frucht, die es früher hier überhaupt nicht gab.
Sorge bereiten die typischen Buchenwälder auf der Schwäbischen Alb. „Sie werden nicht in dieser Form überleben können“, bedauerte der Minister. Buchen leiden unter Trockenheit und höheren Temperaturen. „Der Verfall startet in der Krone“, erklärte Hauk „und dann sterben sie in den nächsten drei bis fünf Jahren ab. Eichen lieben die Wärme mehr. Die werden kommen.“
„Wir müssen versuchen, uns zu wappnen. Es wird trockener und wärmer werden und es wird mehr Starkregenereignisse geben“, betonte Hauk. Neben der Eiche forsche man gerade an anderen Bäumen aus anderen Weltregionen, ob diese sich hier ansiedeln lassen. Es gelte also, die Veränderungsprozesse, die der Klimawandel bewirke, aktiv zu gestalten. Auch durch Forschung in verschiedenen Bereichen. Und jeder einzelne könne etwas tun, etwa in eine PV-Anlage zu investieren oder Blühstreifen im Garten stehen lassen.
Am Ende seiner Rede dankte Hauk dem Schwäbischen Albverein für seine Vereinsarbeit, die dazu beiträgt, dass die Gesellschaft demokratisch verfasst bleibt. Hauk betonte: „Eine stabile Demokratie lebt vom Ehrenamt, von den Vereinen, von engagierten Einzelnen.“
Große Herausforderungen für den Schwäbischen Albverein

Albvereinspräsident Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß wies im Anschluss auf den Vortrag des Ministers auf die Novelle des Bundeswaldgesetzes hin, die gerade in Arbeit ist. „Das freie Betretungsrecht des Waldes darf nicht verloren gehen“, betonte er und forderte Minister Hauk auf, sich persönlich dafür einzusetzen.
Rauchfuß berichtete zudem über die großen finanziellen Herausforderungen, die der Schwäbische Albverein derzeit zu bewältigen hat. Vor allem der Renovierungsbedarf bei den Aussichtstürmen sind für einen gemeinnützigen Verein nur schwer zu stemmen. „Oft treiben versteckte Schäden die Kosten für den Erhalt der Türme in die Höhe“, erklärte Rauchfuß. So etwa beim Katharinenlindenturm oder beim Lembergturm. Rauchfuß dankte allen engagierten Ortsgrupen und Gauen, die Spenden für die Renovierung von Türmen gesammelt haben und noch sammeln. Er forderte aber auch den Tourismus auf, den Erhalt der Türme stärker finanziell zu unterstützen. Die Aussichtstürme seien schließlich wichtige Ausflugsziele in der Region, betonte er.
Weiter erläuterte Rauchfuß Konsolidierungsmaßnahmen, die der Verein derzeit unternehme, um die Finanzen zu stabilisieren. Sinkende Mitgliederzahlen und hohe Kosten hätten nämlich in den vergangenen zwei Jahren zu einem Definit von rund einer halben Million Euro geführt. In einer AG Konsolidierung würden derzeit Sparpotentiale ermittelt.
Die Digitalisierung sei ein weiteres wichtiges Thema für die zukünftige Entwicklung des Vereins, etwa im Bereich der Mitgliederverwaltung. Diese müsse mittelfristig erneuert werden. „Die Digitalisierung soll uns allen das Leben erleichtern“, betonte Rauchfuß und kündigte an, in Regionaltreffen vor Ort über die Planungen und über Möglichkeiten der Finanzierung zu sprechen.
Jugendarbeit mit Zukunft

Hauptjugendwart Mats Thiele stellte den Albvereinsmitgliedern die Arbeit der Schwäbischen Albvereinsjugend anhand ihres Leitbilds vor. Naturerlebnisse, Umweltschutz, demokratische Strukturen sowie ein lebendiges Miteinander sind dabei wichtige Bausteine. „Grundlage unsere Arbeit ist das Ehrenamt“, betonte Thiele. Deshalb fördere die Albvereinsjugend intensiv junge Menschen und führe sie an Verantwortung und Vereinsaufgaben heran.
Außerdem stehe Bildungsarbeit für Ehrenamtliche wie die JULEICA- und Jugendwanderführer*innen-Ausbildung ganz weit oben auf der Agenda. Neu ist die Online-Fortbildungsreiche „Insight OG“ (In den Ortsgruppen), mit der Jugend- und Familiengruppenleitende und alle Interessierten in einer Ortsgruppe Tipps und Infos für eine gelingende Jugendarbeit erhalten.
Herzlichen Dank
an den Esslinger Gau mit seiner Vorsitzenden Karin Feucht und der Ortsgruppe Wernau für die Vorbereitung der Hauptversammlung,
an die Familien- und Jugendarbeit im Albverein für das Kinder- und Jugendprogramm,
an die Gruppe „mannomann“ des Gesangvereins Cäcilia Wernau e.V. und die Kinder- und Jugendgruppen de Ungarndeutschen Folklore-Ensembles Wernau für Gesang und Tanz
und die Stadt Wernau mit Bürgermeisterin Christiane Krieger für die Gastfreundschaft!