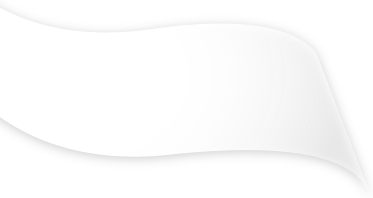Der Ausbau erneuerbarer Energien und der Naturschutz scheinen sich nicht immer grün zu sein. Wie beide trotz aller Konflikte zusammengehen können, wurde beim Naturschutztag des Schwäbischen Albvereins am 12. November in Wernau erörtert.

Der Klimawandel ist auch in Baden-Württemberg angekommen. Immer mehr extreme Wetterereignisse wie Hitzesommer oder Starkregen verursachen große Schäden. Etwa 25 Prozent aller Tier- und Pflanzenarten sind durch den Klimawandel vom Aussterben bedroht. Es ist also höchste Zeit gegenzusteuern, erklärte Regierungspräsidentin Susanne Bay vom Regierungsbezirk Stuttgart in ihrem Beitrag beim Naturschutztag. „Wir sind immer noch viel zu abhängig von fossilen Energieträgern, wie uns auch der Krieg in der Ukraine deutlich vor Augen führt.“ Der Umstieg auf erneuerbare Energien sei deshalb unausweichlich. 2021 lag der Anteil der erneuerbaren Energien an der Bruttostromerzeugung bei 36,3 Prozent. „Da ist deutlich Luft nach oben.“
Strom aus erneuerbaren Energien ist die Zukunft
„Wir brauchen in Zukunft große Solarparks und Windkraftanlagen“, stimmte Franz Pöter, Geschäftsführer der Plattform Erneuerbare Energien Baden-Württemberg e. V. der Regierungspräsidentin zu. „Andernfalls werden wir den Umstieg nicht rechtzeitig schaffen.“ Denn bis 2040 soll Baden-Württemberg klimaneutral werden. Doch ist es realistisch? „Eine sehr bedeutende Reduktion der Treibhausgase ist dafür nötig“, so Pöter beim Naturschutztag. Energiesparen, energieeffiziente Technologien nutzen und die erneuerbaren Energien beim Stromverbrauch und im Wärmebereich ausbauen – das sind die wichtigen Schritte, die nun nötig sind und schnellstmöglich umgesetzt werden sollen.
Emissionen einsparen
Die gute Nachricht ist: Die Erzeugung von Strom aus Wind, Sonne, Wasser und Biomasse ist mittlerweile deutlich günstiger als aus fossilen Energieträgern. Außerdem hat sich die Technik enorm weiterentwickelt. Eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach eines Einfamilienhauses etwa reduziert die CO2-Emissionen um durchschnittlich 10 Tonnen pro Jahr. „Das ist ungefähr so viel, wie jeder von uns als CO2-Päckchen mit sich herumträgt“, rechnet Pöter vor. Mit Solarparks ließen sind noch wesentlich mehr Emissionen einsparen. Im Winterhalbjahr ist dann Windenergie entscheidend. Pöter nennt die Windräder die „Arbeitspferde“ der Stromerzeugung. Und auch hier gilt: Die heutigen Anlagen sind deutlich leistungsstärker als früher. Sie sind höher und die Rotordurchmesser größer, so dass auch bei geringen Windgeschwindigkeiten Strom produziert werden kann.
Hohe Akzeptanz bei der Bevölkerung
Die Bevölkerung hat mittlerweile die Notwendigkeit des Ausbaus erkannt. Pöter verweist auf eine repräsentative Umfrage, die die Plattform Erneuerbare Energien Baden-Württemberg e.V., durchgeführt habe. Selbst im eigenen Wohnumfeld könnten sich mehr als zwei Drittel der Befragten einen Solarpark und immer noch 64 Prozent ein oder mehrere Windräder vorstellen.
Flächen und Genehmigungen nötig
Bis 2040 müssen Wind- und Solarenergie mindestens 80 Prozent des Strommixes in Baden-Württemberg ausmachen, um das ehrgeizige Ziel der Klimaneutralität zu erreichen. „Wir brauchen dafür Flächen und Genehmigungen“, betont Pöter.
Schlüsselfrage nach dem Standort
Doch wo und vor allem auch wie sollen diese Anlagen aus Naturschutzsicht entstehen? Dieser Frage widmeten sich beim Naturschutztag Luca Bonifer und Pia Schmidt vom Dialogforum Energiewende und Naturschutz. Das Dialogforum ist ein Gemeinschaftsprojekt der beiden Naturschutzorganisationen BUND und NABU mit dem Ziel, alle Beteiligten und Betroffenen bei einem naturverträglichen Ausbau der erneuerbaren Energien zu beraten und zu schulen.
Energiewende naturverträglich gestalten
Die beiden Fachfrauen sind davon überzeugt: „Man kann die Energiewende naturverträglich gestalten.“ Das ist wichtig, denn immer wieder geraten die Anliegen des Klimaschutzes mit den Anliegen des Natur- und Artenschutzes in Konflikt. Da brütet der Rotmilan just in der Nähe der Stelle, an der ein Windrad entstehen soll. Oder das Laichgebiet der streng geschützten Gelbbauchunke ist einem Solarpark im Weg. Oder der Flächenverbrauch beim Bau von Windrädern gerade in den Wäldern steht immer wieder in der Kritik.
Keine Windräder in Naturschutzgebieten
„Wir wollen keine Windräder in Naturschutzgebieten und anderen sensiblen Gebieten“, erklärt Bonifer. „Es gibt genug andere, unkritische Flächen.“ Intensiv genutzte Fichtenwälder etwa statt naturnahe, arteinreiche Waldgebiete oder freie Flächen, in denen keine gefährdeten Arten leben. Mit automatischen Abschaltungen könne das Kollisionsrisiko für Fledermäuse gesenkt werden. Mit neuen und attraktiven Jagdhabitaten oder Ersatzlebensräumen könne man die Tiere auch von den Anlagen weglocken. „Bis 2025 müssen in Baden-Württemberg die Windenergiegebiete ausgewiesen werden“, erklärt Bonifer. Hier sei Mitarbeit gefragt, damit sensible Gebiete gar nicht erst in Erwägung gezogen werden.
Photovoltaik auch auf Freiflächen nötig
Was Photovoltaik-Anlagen angeht, so besteht mittlerweile die Pflicht, sie auf Neubauten und Parkplätzen ab einer bestimmten Größe mit einzuplanen. „Aber wir werden nicht drum herum kommen, Anlagen auch auf Freiflächen zu bauen“, stimmt Pia Schmidt ihrem Vorredner Franz Pöter zu. Diese „Freiflächen“ sind in der Regel landwirtschaftliche Nutzflächen. Auf 60 Prozent dieser Flächen werden Futtermittel und auf weiteren 16 Prozent Energiepflanzen angebaut, gibt Schmidt zu bedenken. Ein Solarpark liefere ein Vielfaches an Energie als Mais, der dann in einer Biogasanlage verstromt wird. Wichtig sei also die Frage: Was war vorher auf dieser „Freifläche“?
Solarparks als Natur-Oasen
Werde ein Solarpark richtig geplant und gebaut, mit ausreichend Platz zwischen den Modulen, genug Bodenabstand und Korridoren für Großwild, dann können diese sogar Oasen für Flora und Fauna werden. Blühflächen unter und zwischen den Modulen, eine Schafbeweidung, Nistkästen, Feuchtbiotope sowie Totholz- oder Steinhaufen an den Rändern bieten Insekten, Vögeln, Eidechsen und Amphibien eine Heimat und Nahrung. „Wenn eine Anlage erst mal steht, gibt es wenig Störungen, d.h. die Natur kann sich ausbreiten“, erklärt Schmidt.
Wichtig: Sich bei der Planung einmischen
Es gibt also Lösungen, um den Ausbau der erneuerbaren Energien naturverträglich zu gestalten. Gerade die Standortwahl ist dabei entscheidend. Naturschützerinnen und Naturschützer sowie Menschen mit Ortskenntnis müssten sich deshalb rechtzeitig in die Planungen einbringen, so dass die Anlagen an der richtigen Stelle entstehen und mit entsprechenden Ausgleichsmaßnahmen geplant werden, betonen Schmidt und Bonifer. Das Dialogforum Energiewende und Naturschutz bietet hierbei Unterstützung und Beratung an.