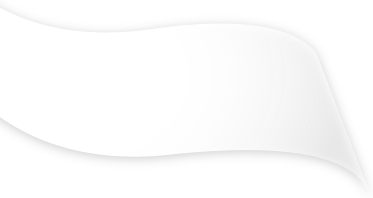Eines der Bekanntesten ist der Federsee bei Bad Buchau. Dort können Sie auf einem Steg trockenen Fußes durch Feuchtwiesen und Schilf bis zu einer offenen Wasserfläche laufen. Dazu gibt es den Federsee-Rundweg, einen 6 Kilometer langen Rad- und Wanderweg. Der ausgeschilderte Stationenweg mit Infos zu Fauna und Flora startet am Federseeparkplatz und führt direkt an der Naturschutzgebietsgrenze entlang rund um den Federsee.
Schlagwort-Archive: Klimaschutz
Baden-Württemberg auf dem Weg zur Klimaneutralität
Der Ausbau erneuerbarer Energien und der Naturschutz scheinen sich nicht immer grün zu sein. Wie beide trotz aller Konflikte zusammengehen können, wurde beim Naturschutztag des Schwäbischen Albvereins am 12. November in Wernau erörtert.

Der Klimawandel ist auch in Baden-Württemberg angekommen. Immer mehr extreme Wetterereignisse wie Hitzesommer oder Starkregen verursachen große Schäden. Etwa 25 Prozent aller Tier- und Pflanzenarten sind durch den Klimawandel vom Aussterben bedroht. Es ist also höchste Zeit gegenzusteuern, erklärte Regierungspräsidentin Susanne Bay vom Regierungsbezirk Stuttgart in ihrem Beitrag beim Naturschutztag. „Wir sind immer noch viel zu abhängig von fossilen Energieträgern, wie uns auch der Krieg in der Ukraine deutlich vor Augen führt.“ Der Umstieg auf erneuerbare Energien sei deshalb unausweichlich. 2021 lag der Anteil der erneuerbaren Energien an der Bruttostromerzeugung bei 36,3 Prozent. „Da ist deutlich Luft nach oben.“
Strom aus erneuerbaren Energien ist die Zukunft
„Wir brauchen in Zukunft große Solarparks und Windkraftanlagen“, stimmte Franz Pöter, Geschäftsführer der Plattform Erneuerbare Energien Baden-Württemberg e. V. der Regierungspräsidentin zu. „Andernfalls werden wir den Umstieg nicht rechtzeitig schaffen.“ Denn bis 2040 soll Baden-Württemberg klimaneutral werden. Doch ist es realistisch? „Eine sehr bedeutende Reduktion der Treibhausgase ist dafür nötig“, so Pöter beim Naturschutztag. Energiesparen, energieeffiziente Technologien nutzen und die erneuerbaren Energien beim Stromverbrauch und im Wärmebereich ausbauen – das sind die wichtigen Schritte, die nun nötig sind und schnellstmöglich umgesetzt werden sollen.
Emissionen einsparen
Die gute Nachricht ist: Die Erzeugung von Strom aus Wind, Sonne, Wasser und Biomasse ist mittlerweile deutlich günstiger als aus fossilen Energieträgern. Außerdem hat sich die Technik enorm weiterentwickelt. Eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach eines Einfamilienhauses etwa reduziert die CO2-Emissionen um durchschnittlich 10 Tonnen pro Jahr. „Das ist ungefähr so viel, wie jeder von uns als CO2-Päckchen mit sich herumträgt“, rechnet Pöter vor. Mit Solarparks ließen sind noch wesentlich mehr Emissionen einsparen. Im Winterhalbjahr ist dann Windenergie entscheidend. Pöter nennt die Windräder die „Arbeitspferde“ der Stromerzeugung. Und auch hier gilt: Die heutigen Anlagen sind deutlich leistungsstärker als früher. Sie sind höher und die Rotordurchmesser größer, so dass auch bei geringen Windgeschwindigkeiten Strom produziert werden kann.
Hohe Akzeptanz bei der Bevölkerung
Die Bevölkerung hat mittlerweile die Notwendigkeit des Ausbaus erkannt. Pöter verweist auf eine repräsentative Umfrage, die die Plattform Erneuerbare Energien Baden-Württemberg e.V., durchgeführt habe. Selbst im eigenen Wohnumfeld könnten sich mehr als zwei Drittel der Befragten einen Solarpark und immer noch 64 Prozent ein oder mehrere Windräder vorstellen.
Flächen und Genehmigungen nötig
Bis 2040 müssen Wind- und Solarenergie mindestens 80 Prozent des Strommixes in Baden-Württemberg ausmachen, um das ehrgeizige Ziel der Klimaneutralität zu erreichen. „Wir brauchen dafür Flächen und Genehmigungen“, betont Pöter.
Schlüsselfrage nach dem Standort
Doch wo und vor allem auch wie sollen diese Anlagen aus Naturschutzsicht entstehen? Dieser Frage widmeten sich beim Naturschutztag Luca Bonifer und Pia Schmidt vom Dialogforum Energiewende und Naturschutz. Das Dialogforum ist ein Gemeinschaftsprojekt der beiden Naturschutzorganisationen BUND und NABU mit dem Ziel, alle Beteiligten und Betroffenen bei einem naturverträglichen Ausbau der erneuerbaren Energien zu beraten und zu schulen.
Energiewende naturverträglich gestalten
Die beiden Fachfrauen sind davon überzeugt: „Man kann die Energiewende naturverträglich gestalten.“ Das ist wichtig, denn immer wieder geraten die Anliegen des Klimaschutzes mit den Anliegen des Natur- und Artenschutzes in Konflikt. Da brütet der Rotmilan just in der Nähe der Stelle, an der ein Windrad entstehen soll. Oder das Laichgebiet der streng geschützten Gelbbauchunke ist einem Solarpark im Weg. Oder der Flächenverbrauch beim Bau von Windrädern gerade in den Wäldern steht immer wieder in der Kritik.
Keine Windräder in Naturschutzgebieten
„Wir wollen keine Windräder in Naturschutzgebieten und anderen sensiblen Gebieten“, erklärt Bonifer. „Es gibt genug andere, unkritische Flächen.“ Intensiv genutzte Fichtenwälder etwa statt naturnahe, arteinreiche Waldgebiete oder freie Flächen, in denen keine gefährdeten Arten leben. Mit automatischen Abschaltungen könne das Kollisionsrisiko für Fledermäuse gesenkt werden. Mit neuen und attraktiven Jagdhabitaten oder Ersatzlebensräumen könne man die Tiere auch von den Anlagen weglocken. „Bis 2025 müssen in Baden-Württemberg die Windenergiegebiete ausgewiesen werden“, erklärt Bonifer. Hier sei Mitarbeit gefragt, damit sensible Gebiete gar nicht erst in Erwägung gezogen werden.
Photovoltaik auch auf Freiflächen nötig
Was Photovoltaik-Anlagen angeht, so besteht mittlerweile die Pflicht, sie auf Neubauten und Parkplätzen ab einer bestimmten Größe mit einzuplanen. „Aber wir werden nicht drum herum kommen, Anlagen auch auf Freiflächen zu bauen“, stimmt Pia Schmidt ihrem Vorredner Franz Pöter zu. Diese „Freiflächen“ sind in der Regel landwirtschaftliche Nutzflächen. Auf 60 Prozent dieser Flächen werden Futtermittel und auf weiteren 16 Prozent Energiepflanzen angebaut, gibt Schmidt zu bedenken. Ein Solarpark liefere ein Vielfaches an Energie als Mais, der dann in einer Biogasanlage verstromt wird. Wichtig sei also die Frage: Was war vorher auf dieser „Freifläche“?
Solarparks als Natur-Oasen
Werde ein Solarpark richtig geplant und gebaut, mit ausreichend Platz zwischen den Modulen, genug Bodenabstand und Korridoren für Großwild, dann können diese sogar Oasen für Flora und Fauna werden. Blühflächen unter und zwischen den Modulen, eine Schafbeweidung, Nistkästen, Feuchtbiotope sowie Totholz- oder Steinhaufen an den Rändern bieten Insekten, Vögeln, Eidechsen und Amphibien eine Heimat und Nahrung. „Wenn eine Anlage erst mal steht, gibt es wenig Störungen, d.h. die Natur kann sich ausbreiten“, erklärt Schmidt.
Wichtig: Sich bei der Planung einmischen
Es gibt also Lösungen, um den Ausbau der erneuerbaren Energien naturverträglich zu gestalten. Gerade die Standortwahl ist dabei entscheidend. Naturschützerinnen und Naturschützer sowie Menschen mit Ortskenntnis müssten sich deshalb rechtzeitig in die Planungen einbringen, so dass die Anlagen an der richtigen Stelle entstehen und mit entsprechenden Ausgleichsmaßnahmen geplant werden, betonen Schmidt und Bonifer. Das Dialogforum Energiewende und Naturschutz bietet hierbei Unterstützung und Beratung an.
Klimawandel verändert das Wandern
Die Wandervereine stehen angesichts der Klimaerwärmung vor großen Herausforderungen. Hitze und Trockenheit einerseits, Starkregen und Überschwemmungen andererseits, dazu Astbruchgefahr, zerstörte Wanderwege und Markierungen – das Wandern wird sich in den nächsten Jahrzehnten sehr verändern. Ebenso wie die Landschaft.

Aufgrund der Trockenheit herbstelt es bereits in den Wälern.
Die Baumkronen verfärben sich, Äste tragen nur noch buntes Laub oder sind schon ganz kahl. Es herbstelt bereits in den Wäldern. Dabei ist es erst August, noch mitten im Hochsommer. Doch nach Wochen mit Dauerhitze und Trockenheit reicht es den Bäumen. Sie sind müde und gehen verfrüht in die Pause. Und nicht nur sie. Die Erde ist staubtrocken, das Gras verdörrt und die Blumenbeete im Garten sind nur noch bunt, weil man sie regelmäßig gießt. In diesem Sommer wird es auch den letzten „Klimaskeptikern“ klar: Das ist nicht normal. Der Klimawandel steht nicht vor der Tür, er hat die Tür bereits eingetreten.
Temperaturen steigen – Trockenheit nimmt zu
Der vorherige Satz ist ein Zitat von Dr. Andre Baumann. Der Staatssekretär im baden-württembergischen Umweltministerium sprach beim 121. Deutschen Wandertag in der Schwabenlandhalle in Fellbach vor den Delegierten der Wandervereine über das Thema Klimawandel und welche Rolle den Wandervereinen dabei zukommt. Wir alle wandern doch gerne durch unsere idyllischen Kulturlandschaften und erfreuen uns an gewohnten Landschaftsbildern wie lichten Buchenwäldern, saftigen Streuobstwiesen, gepflegten Wacholderheiden und bunten Blumenwiesen. Doch wie lange ist das noch möglich?

Fichtenwälder wird es in naher Zukunft in Deutschland kaum mehr geben.
In Baden-Württemberg ist die Durchschnittstemperatur seit Beginn der Wetteraufzeichnung im Jahr 1881 um rund 1,5 Grad angestiegen. 80 Prozent der Flüsse und Bäche führen derzeit Niedrigwasser, 40 Prozent aller wildlebenden Tier- und Pflanzenarten sind gefährdet. Wie wird es zum Ende des Jahrhunderts aussehen im Land? Wird es noch Nadelwälder geben? Saftige grüne Wiesen? Schnee im Winter und genug Regen in den anderen Jahreszeiten? Momentan sieht es nicht danach aus. „Wir steuern auf sizilianische Verhältnisse zu“, so Baumann. Dann wird von den Fichtenwäldern des Schwarzwalds, aber auch im Harz, im Sauerland, im Bayerischen Wald oder anderswo nichts mehr übrig sein.
Vor allem Flachwurzler wie die Fichte leiden
Die Fichte leidet massiv unter der Kombination aus Wassermangel, Hitze und Borkenkäferbefall. Forstexperten bezweifeln, dass der „Brotbaum der mitteleuropäischen Forstwirtschaft“, wie sie kürzlich in einem Artikel in der Stuttgarter Zeitung genannt wurde, noch eine große Zukunft hat. Als Flachwurzler macht ihr die Trockenheit sehr zu schaffen. So angeschlagen hat die Fichte extremen Wetterereignissen, wie etwa Stürmen, nichts entgegen zu setzen. Sturm Kyrill etwa machte im Jahr 2007 in Nordrhein-Westfalen 25 Millionen Bäumen den Garaus – in einer Nacht. 95 Prozent davon waren Fichten. Immerhin hat man aus der Katastrophe etwas gelernt und vorwiegend Mischwälder aufgeforstet.

Müssen künftig mehr Wegmarkierungen an Pfosten aufgestellt werden, wenn die Wälder weniger werden? In manchen Gegenden wie im Sauerland oder im Harz ist das bereits Realität.
Trotzdem klaffen immer mehr Lücken. Thomas Gemke, der Vorsitzende des Sauerlandvereins, berichtet: „In manchen Gegenden haben wir gar keine Bäume mehr, an denen wir Markierungen befestigen können. Wir müssen stattdessen Pfosten in die Erde rammen.“ Auch Starkregenereignisse tun der Natur nicht gut. Fruchtbarer Humus wird weggeschwemmt, Wälder, Felder und Siedlungen zerstört, ebenso Wanderinfrastruktur wie Wanderwege, Markierungen und Rastplätze. Ein Blick ins Ahrtal zeigt, wo die Reise hingeht, wenn wir nicht gegensteuern.
Wann und wo wird man noch wandern können?
Doch nicht nur die Wegewarte merken den Klimawandel bei ihrer ganz praktischen Arbeit. Auch bei der Wanderführerausbildung spielt er zunehmend eine Rolle. Was tun bei Waldbrandgefahr? Können Rast- und Grillplätze überhaupt noch genutzt werden? Welche Wege sind wegen der Gefahr von Astbruch zu meiden? Und kann bei den hohen Temperaturen im Sommer überhaupt noch zu normalen Tageszeiten und in gewohnter Länge gewandert werden? All diese Fragen spielen bei der Ausbildung eine Rolle. Ebenso wie der Naturschutz. „Unsere Wanderführerinnen und Wanderführer sind wichtige Multiplikatoren bei diesem Thema“, erklärt Karin Kunz, die Geschäftsführerin der Heimat- und Wanderakademie in Baden-Württemberg.

Was man kennt, das schützt man gerne. Bildungsarbeit im Bereich Arten- und Naturschutz wird bei den Wandervereinen wie dem Schwäbischen Albverein groß geschrieben.
Wie wichtig die Natur für den Menschen ist, hat sich vor allem auch während der Corona-Pandemie gezeigt. In Scharen zog es die Leute hinaus, oft auch in sensible Gebiete. Ihnen Wertschätzung und Wissen über die Landschaft, ihre Flora und Faune zu vermitteln, ist eine wichtige Aufgabe, der sich Wandervereine wie der Schwäbische Albverein widmen. Viele sind anerkannte Naturschutzverbände mit viel Wissen in den Bereichen Natur-, Arten- und Landschaftsschutz.
Wandervereine müssen sich einbringen beim Klimaschutz
„Wir brauchen die Expertise der Wander- und Naturschutzverbände“, betonte Dr. Andre Baumann in Fellbach. Er bat sie auch um Mitarbeit bei der Vernetzung von Ökosystemen, dem sogenannten Biotopverbund, an dem in Baden-Württemberg massiv gearbeitet werde. Und um Kooperation beim nötigen Ausbau von Wind- und Solarenergie. Hier gibt es immer wieder Konflikte. Denn es ist in der Tat die Wahl zwischen Pest und Cholera. Windräder und Solarparks sollen auch in Landschaftsschutzgebieten entstehen. Photovoltaik auf Dächern allein reiche nicht, so Baumann.

Das Landschaftsbild wird sich verändern – Windkraftanlagen und Solarparks sind vielen deshalb ein Dorn im Auge. Die Frage ist: Was ist das kleinere Übel?
Eine Zumutung für viele, das sieht auch der Staatssekretär ein, verändern die Anlagen doch das Landschaftsbild. „Wenn wir aber nichts tun, dann wird der Klimawandel unsere Landschaft so stark verändern, wie wir uns das heute gar nicht vorstellen können.“ Solarparks und Windkraftanlagen seien im Vergleich noch maßvoll, erklärt Baumann, der selbst über viele Jahr Vorsitzender eines Naturschutzverbandes war. Sein Aufruf an die Wanderverbände: Bringt Euch ein, redet mit, denkt mit und bestimmt mit. „Es kommt halt darauf an, wo und wie man baut“, so Baumann weiter. Naturschonend solle es sein, mit Schafbeweidung, ohne Düngung, so dass neben und unter den Anlagen „Hotspots der biologischen Vielfalt“ entstehen könnten.
Deutscher Wandertag: Wetter ein Vorbote für das, was kommt.
Beim 121. Deutschen Wandertag konnten sich alle Teilnehmenden sowie die Wanderführerinnen und Wanderer persönlich davon überzeugen, dass die Warnungen vor den Auswirkungen des Klimawandels keine heiße Luft sind und sich auch das Wandern in den nächsten Jahrzehnten nachhaltig verändern könnte. Bei bis zu 38 Grad war manche Tour nicht wie geplant möglich, Tourenverläufe mussten verändert oder abgekürzt werden. Trinkwasser war ein begehrtes Gut. Was bleibt ist neben der Freude an einem gelungenen Wandertag deshalb auch Nachdenklichkeit und ein flaues Gefühl im Magen bei dem Gedanken, was uns wohl noch bevorsteht. Es ist Zeit für die Wanderverbände, noch mehr zu tun für den Klimaschutz. Bei der Feierstunde in Fellbach warnte Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Schirmherr der Veranstaltung, eindringlich: „Uns bleiben nur noch wenige Jahre um die Klimaerhitzung zu bremsen. Wenn es zu heiß wird, dann wird es auch unsere Kulturlandschaften so nicht mehr geben. Dann wird das Wandern in diesen Landschaften nicht mehr so sein, wie wir Sie kennen.“
Bitte vormerken!
Am Samstag, 12. November, veranstaltet der Schwäbische Albverein seinen diesjährigen Naturschutztag. Das Thema: Klimaschutz und Klimaanpassung. Weitere Infos in Kürze.