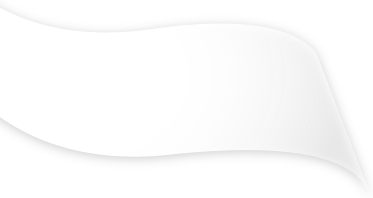Naturgenuss und Naturzerstörung liegen oft recht nah beieinander. Wie umgehen mit dem gestiegenen Besucherdruck in landschaftlich attraktiven Gebieten, mit Müll und zertrampelten Pflanzen, mit Autos in Schutzgebieten, Lärm und Konflikten zwischen verschiedenen Nutzergruppen. Beim 16. Naturschutztag des Schwäbischen Albvereins Anfang November in Plochingen ging es um diese Fragen und mögliche Antworten darauf.

Thomas Dietz, stellvertretender Vorsitzender des Landesnaturschutzverbands Baden-Württemberg, brachte es auf den Punkt: „Wir leben in einer Spaß- und Freizeitgesellschaft bei zunehmender Naturferne“, sagte er in seinem Grußwort beim Naturschutztag in Plochingen. Allerdings ist die Übernutzung von landschaftlich attraktiven Ausflugszielen durch Ausflügler kein neues Phänomen. Dr. Marco Drehmann, Geschäftsführer des Naturschutzzentrums Schopflocher Alb, berichtete in seinem Beitrag einer Mappe Heinz Dangels, dem damalige Gauobmann des Teck-Neuffen-Gaus des Schwäbischen Albvereins, in dem Fotos vom Breitenstein und dem Randecker Maar zu finden sind. Die Bilder zeigen Falschparker, Menschenmassen, die abseits aller Wege unterwegs sind, und illegale Feuerstellen. Dazu kommen empörte Aufzeichnungen des Albvereinlers ob dieses Zustands.

Soziale Kontrolle funktioniert gut – Müll als Problem
Heute funktioniere das deutlich besser in den genannten Gebieten, erklärte Drehmann. Es gebe abgegrenzte Parkplätze, öffentliche Feuerstellen, und eine Wegebindung etwa durch das Schopflocher Moor auf dem Bohlenweg. Auch die soziale Kontrolle funktioniere gut, etwa wenn Menschen illegale Feuer entfachten und von anderen darauf angesprochen werden. Die Aufklärung der vergangenen Jahrzehnte durch Naturschutzverbände wie den Schwäbischen Albverein sowie durch die Ranger am Esslinger Albtrauf habe hier gute Wirkung gezeigt. Momentan sei vor allem der Müll ein Problem – „normaler“ Picknickmüll, aber auch die illegale Entsorgung von gewerblichem Müll an Wanderparkplätzen.
Drehmann setzt vor allem auf Bildungsangebote – die Eskalation der Situation während der Corona-Pandemie sowie die Jagd nach dem schönsten Instagram-Photo zeige, dass es besonders wichtig sei, bei den Kindern und Jugendlichen anzusetzen. „Das sind die Naturnutzer von morgen.“

Freizeit in der Natur in der Regel unproblematisch – E-Bikes intensivieren Druck
„In der Regel ist Freizeit in der Natur in Deutschland unproblematisch“, stellte Thomas Fickert fest. Er ist für Naturschutz beim Landesverband Baden-Württemberg des Deutschen Albvereins zuständig. Ausnahmen seien besondere landschaftliche Attraktionen oder die Nähe zu Ballungszentren. Vor allem für Schutzgebiete brauche man Konzepte und Maßnahmen der Besucherlenkung. Allerdings dürfe Naturschutz nicht den Ausschluss von Menschen aus der Natur zur Folge haben. Der DAV setze auf einvernehmliche Lösungen, auf Kompromisse, die dann auch von den Menschen akzeptiert werden.
Problematisch sieht Fickert den Trend zu E-Mountain-Bikes. „In den Mittelgebirgen führt das dazu, dass die Leute einen Trail häufiger als einmal befahren können. In den Alpen kommen sie mit einem E-Bike in Höhenlagen, wo sie vorher nicht fahren konnten. Damit steig der Druck in diesen Gebieten.“

Nicht eine, sondern bunter Mix an Besucherlenkungsmaßnahmen führen zum Erfolg
Heidrun Nübing ist in der Geschäftsstelle des Biosphärengebiet Schwäbische Alb für Besucherlenkung zuständig. Sie berichtete beim Naturschutztag über die Besucherlenkungsmaßnahmen auf der Schwäbischen Alb. Sie betreffen vor allem Kernzone, die nur einen sehr kleinen Teil der Fläche ausmacht, und teilweise auch die Pflegezone, also die Kulturlandschaften auf der Alb wie Wacholderheiden und Streuobstwiesen.
Keine guten Erfahrungen habe man mit der Beschilderung der Kernzonen gemacht, berichtete Nübing. Gesperrte Wege würden häufig weiterhin genutzt. Die Arbeit der sieben Ranger im Biosphärengebiet werde deutlich besser angenommen. Sie gehen gerade an schönen Wochenenden auf Streife in der Kernzone und in Naturschutzgebieten. „Im persönlichen Kontakt erreicht man viele Menschen“, bilanzierte Nübing.

Die Kapazitäten der Ranger reichten aber bei weitem nicht aus. So gebe es zum Beispiel zur Märzenbecherblüte im Wolfstal immer wieder Trampelpfade, die sich zu richtigen Wegen verbreiterten, weil Menschen einfach querfeldein durch den Wald liefen. Hier arbeite man dann doch wieder mit Schildern.
Gut ausgeschilderte Wanderwege als wichtiges Mittel der Besucherlenkung
Weitere Methoden der Besucherlenkung sei die Blockade von illegalen Wegen mit Baumstämmen, Ästen und Zweigen. Ziel sei, der Natur Zeit und Raum zu geben, sich verbotene Wege zurückzuholen. Besonders wichtig sei, ein gut ausgeschildertes und attraktives Wanderwegenetz sowie naturverträgliche Wanderangebote. Derzeit werde das Albvereins-Wegenetz im Biosphärengebiet neu beschildert. Dazu kommen die Hochgehberge, als attraktive touristische Wege, die gerne angenommen werden, sensible Gebiete aber aussparten.

Relativ neu ist die Arbeit einer „digitalen Rangerin“, die das Angebot in den Touren-Apps und -Portalen wie Komoot und Outdooractive pflegt. Sie sorgt dafür, dass Kernzonen und gesperrte Wege dort eingetragen werden. Das sei sehr arbeitsaufwendig, erklärte Nübing, da die Portale ständig durchforstet werden müssten. Mittlerweile nutze man für diese Aufgabe die Dienste des Vereins „Digitize the Planet“, der Informationen über Schutzgebiete, Verhaltensregel und weitere Informationen standardisiere. Die Tourenportale können sie dann gesammelt eingelesen und eingeblenden. Outdooractive und einige andere Portale nutzten den Dienst bereits, so Nübing, Komoot leider noch nicht.
„Wir werden nie alle Menschen erreichen“, resümierte Heidrun Nübing beim Naturschutztag. „Um aber möglichst viele Menschen zu erreichen, müssen wir möglichst viele Methoden der Besucherlenkung miteinander kombinieren.“

Forschungsprojekt „Wir im Wald“
Ziel des Forschungsprojekts „Wir im Wald“ ist es erholungsbedingte Nutzungskonflikte im Wald zu vermeiden und durch aktive Dialog- und Beteiligungsprozesse zu entschärfen. So stand es auf den Folien von Prof. Dr. Monika Bachinger von der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg und Prof. Dr. Alexander Mäder von der Hochschule der Medien in Stuttgart.
Kern des Forschungsprojekts ist die sogenannte Deliberation als Möglichkeit der konstruktiven, empathischen und respektvollen Kommunikation zwischen Nutzergruppen. Dafür wurden bestimmte Nutzungskonflikte in Beispielsregionen untersucht – etwa Radfahrer versus Wanderer, die Wahrnehmung von Waldwirtschaft als destruktive Maßnahmen durch den Forst, Regelüberschreitungen von Erholungssuchenden. Studierende der Hochschule für Medien haben die Aufgabe, Kommunikationskonzepte für die Konflikte zu erarbeiten.

Alles nicht so einfach, so das Fazit von Professor Mäder. Denn man erreiche die Menschen nicht gleichzeitig auf einem Kanal. Aber man können die Aussagen einer Gruppe in einen Kanal der anderen Gruppe einbringen. Wichtig sei dabei vor allem, die Konflikte genau zu analysieren und zu durchleuchten. Die Medien könnten die Wahrnehmung ganz stark beeinflussen. Trotzdem sei könne mediale Kommunikation nur ein Teilbereich in der Bewältigung von Nutzungskonflikten. Gemeinsames Üben von Verständnis sei genauso wichtig. Bewährt hätten sich zum Beispiel gemeinsame Waldspaziergänge mit verschiedenen Akteuren, bei denen sie ihre Argumente austauschen können.
Beispiele für mehr Verständnis zwischen Nutzergruppen könnten etwa sein, dass der Forst das ästhetische Empfinden der Menschen bei forstwirtschaftlichen Maßnahmen mitdenkt, umgekehrt aber auch stärker aufklärt, warum bestimmte Dinge im Wald getan werden müssten, erklärte Professor Bachinger. Etwa Kahlschläge oder die Nutzung von Rückegassen. Doch auch jeder Einzelne ist gefragt, sich verantwortlich in der Natur zu bewegen. Denn flächendeckende Kontrollen seien durch den Forst oder andere öffentliche Stellen kaum zu leisten.
Präsentation Forschungsprojekt „Wir im Wald“

Praktische Tipps bei der Schutzgebietsüberwachung vom Feldberg-Ranger
Zum Schluss des Naturschutztags lockerte der Feldberg-Ranger mit seinem humorvollen Beitrag die Stimmung im Saal auf. Achim Laber ist seit 35 Jahren im Naturschutz tätig und kümmert sich um das größte Naturschutzgebiet in Baden-Württemberg, das zugleich das größte Skigebiet im Land ist – den Feldberg im Schwarzwald.
„Der Ton macht die Musik“, so könnte man seinen Beitrag überschreiben. „Die Menschen müssen verstehen, warum sie sich an Regeln halten sollen“, erklärte Laber. Er empfiehlt, mit den Erholungssuchenden ins Gespräch zu kommen, sich freundlich zu unterhalten, auf die Leute einzugehen und erst dann auf den Regelverstoß zu sprechen zu kommen. „Nicht mit dem Verbot starten, sondern den Grund eines Verbots erklären“, betonte Laber. Empathie eben – so wie es in der Deliberation des Forschungsprojekts „Wir im Wald“ auch gefordert wird.
Das sei natürlich ein schmaler Grad. „Einerseits schmeißen wir die Leute aus der Natur heraus, andererseits wollen wir sie für die Natur interessieren“, so Laber. Wenn man also Nein sage zu etwas, dann braucht man Alternativen. Etwa einen Tipp für den nächsten schönen Badesee, um ein Badeverbot an einem Gewässer durchzusetzen, oder die Adresse für einen schönen Zeltplatz alternativ zum Wildcampen.
Und wenn der Kontakt mit uneinsichtigen Naturnutzenden doch eskaliert? „Die körperliche Unversehrtheit ist das oberste Ziel!“ betonte der Feldberg-Ranger. „Es ist doch so“, sagte Laber, „zwei Prozent Trottel verträgt ein Naturschutzgebiet.“ Er rät Ehrenamtlichen im Streifendienst deshalb, sich aus zu konfliktiven Situation herauszunehmen, gegebenenfalls den Dienst an dem Tag generell abzubrechen. Und beim nächsten Mal das Gespräch vor allem mit den Menschen zu suchen, die zuhören und mit denen man sich verständigen kann.
Leitfaden Schutzgebietsüberwachung (Achim Laber)

Liebe zur Natur als Grundlage für ein friedliches Miteinander in der Natur
Zum Abschluss des Naturschutztags dankte Albvereinspräsident Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß allen Referentinnen und Referenten für ihren Vortrag. Naturkundliche Themen in der Wanderführerausbildung, der Schulwanderwettbewerb für Kinder und naturkundliche Bildungsveranstaltungen und Exkursionen im Schwäbischen Albverein hätten am Ende vor allem ein Ziel – die Liebe für die Natur zu wecken, so Rauchfuß. Das sei der erste Schritt, um Regeln in der Natur anzunehmen bzw. gut vermitteln zu können.
Weitere Informationen