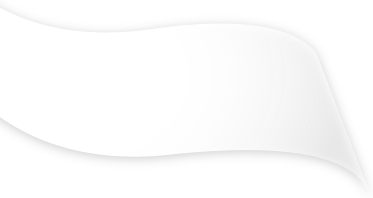Das 4,8 ha große flächenhafte Naturdenkmal Weigoldsbergheide und das 110 ha große Naturschutzgebiet Haarberg/Wasserberg befinden sich auf der Filsalb bei Reichenbach im Täle über dem Fischbachtal. Das NSG Haarberg / Wasserberg ist eines der vielfältigsten und größten Schutzgebiete im Landkreis Göppingen. Weiterlesen
Archiv des Autors: admin
Landesfest-Wimpelwanderung 2013
Von Bad Friedrichshall nach Plochingen
3. Juni 2013, 1. Tag: Bad Friedrichshall – Kochendorf – Weinsberg
Nach vielen Tagen mit Regen und vielfachen Überschwemmungen, vor allem auch am Neckar, änderte sich zu Beginn unserer »Landesfest-Wimpelwanderung» das Wetter, und wir konnten zuversichtlich gestimmt am 3. Juni in Bad Friedrichshall starten.
 Nach einem Empfang bei Herrn Bürgermeister Dolderer im Rathaus und der feierlichen Übergabe des »Landesfestwimpels» begannen wir, sieben ständige Wimpelwanderer, den ganzen Tag begleitet von Herrn BM Dolderer und weiteren Wanderfreunden aus Bad Friedrichshall, unsere Wanderung. Sie führte in östlicher Richtung zur Siedlung Plattenwald, weiter über Mönchswald nach Gellmersbach. Die dortige Leonhardskirche ist mit einer Kette umspannt und wurde dadurch zu einer »Kettenkirche». Sie hatte nach dem 2. Weltkrieg eine Notglocke, die noch heute sichtbar an der Außenfront angebracht ist.
Nach einem Empfang bei Herrn Bürgermeister Dolderer im Rathaus und der feierlichen Übergabe des »Landesfestwimpels» begannen wir, sieben ständige Wimpelwanderer, den ganzen Tag begleitet von Herrn BM Dolderer und weiteren Wanderfreunden aus Bad Friedrichshall, unsere Wanderung. Sie führte in östlicher Richtung zur Siedlung Plattenwald, weiter über Mönchswald nach Gellmersbach. Die dortige Leonhardskirche ist mit einer Kette umspannt und wurde dadurch zu einer »Kettenkirche». Sie hatte nach dem 2. Weltkrieg eine Notglocke, die noch heute sichtbar an der Außenfront angebracht ist.
Durch die herrlichen und weitläufigen Parkanlagen von Weißenhof (Psychiatrisches Zentrum) wurde durch Weinberge die Stadt Weinsberg mit ihrer Burg »Weibertreu» angewandert.
An der »Stauferstele» unterhalb der Burg wurden wir von einer von Dr. Lay vom Weinbauinstitut kommentierten Kernerweinprobe und Brezeln überrascht. Frau Eberle, gekleidet im Gewand einer Bürgersfrau aus der Zeit des Dichters und Arztes Justinus Kerner, führte anschließend gekonnt und humorvoll unsere Wandergruppe in der Burg Weibertreu, erzählte dabei verschiedene Geschichten und Anekdoten. Am frühen Abend, auf dem Weg zur Pension, kam auch die Sonne hinter den Wolken hervor. Später traf man sich nochmals mit zahlreichen Wanderfreunden aus Weinsberg und ließ den ersten Wandertag froh und gemütlich bei einem »Viertele»ausklingen.
4. Juni 2013, 2. Tag: Weinsberg – Naturfreundehaus »Steinknickle»
Die Sonne schien, und es war schon recht warm, als wir – inzwischen war unsere ständige Truppe auf neun Wimpelwanderer, die bis Plochingen dabei sein wollten, angewachsen – begleitet von drei Wanderfreunden aus Weinsberg zur zweiten Etappe aufbrachen. Sie führte zum Stämmlesbrunnen und durch das Stadtseetal auf dem HW 8, dem Frankenweg zur Reisbergbrücke (Brücke über die A 81).
Dort warteten zwei Wanderführer der Ortsgruppe Obersulm, die uns sowohl durch schöne und Schatten spendende Wälder, als auch auf einer alten Römerstraße zum »Teusserbad» bei Löwenstein brachten.
Während der Mittagspause beim Teusserbad hatten wir einen Presse- und Fototermin.
Gestärkt ging es, begleitet von zwei Wanderfreunden der Ortsgruppe Löwenstein zuerst über ca. 200 Treppenstufen hoch in den Ort, vorbei am Geburtshaus von Friederike Hauffe, als »Seherin von Prevorst»berühmt geworden, heute »Manfred-Kyber-Museum»und teilweise durch den Wald weiter zur Burg Löwenstein und einem herrlichen Aussichtspunkt, der eine 180 Grad Aussicht ermöglichte. In der Ferne sah man den »Katzenbuckel». Die Wanderung führte weiter über Hirrweiler, Horkenberg zum »Chausseehaus», wo die Wanderführer aus Wüstenrot uns empfingen und über Bernbach, den Ortsteil Hasenhof zum Naturfreundehaus »Steinknickle» brachten.
Außerhalb des Ortsteils Hasenhof wurden wir und unsere Augen mit einer herrlichen Orchideenwiese für unsere Mühen an diesem Tag belohnt.
Auch dieser Wandertag endete gemütlich bei einer Einkehr im Kreise der zahlreichen Wanderfreunde aus Neuhütten und Umgebung und später noch im Naturfreundehaus Steinknickle.
5. Juni 2013, 3. Tag: »Steinknickle»– Sulzbach/Murr – WH Eschelhof
Bei schönstem Wetter starteten wir zum dritten Wandertag. Hervorragend geführt und informiert von Adolf Feucht aus Neuhütten, wanderten wir vorbei an prächtig blühenden Blumenwiesen, kleinen Teichen zum »Finsterroter See». Nach kurzem Aufenthalt und Verschnaufen ging es weiter durch Finsterrot, Kuhnweiler auf wunderschönen Wegen durch den Wald zur »Seewiese».
Nun waren wir im Rems-Murr-Gau angekommen. Bei der Seewiese gab’s Getränke, Kaffee und kleine Imbisshappen, was für eine willkommene, angenehme Überraschung sorgte; bei den herrschenden Temperaturen durchaus angebracht. Wir waren dafür sehr dankbar.
Mit Helmut Winter aus Sulzbach an der Murr wanderten wir auf mit herrlichen Blumenwiesen gesäumten Wegen nach Großhöchberg zur Mittagspause mit Einkehr im »Kabirinett», einem kleinen Theater. Dort gab es gekühlte Getränke, das mitgebrachte Vesper wurde dabei verzehrt. Ausgeruht und gestärkt ging es durch Kleinhöchberg hindurch, und der Abstieg im Wald nach Sulzbach an der Murr nahte.
Nach dem Fototermin beim Schloss steuerten wir das Rathaus an, vor dem bereits Herr Bürgermeister Zahn wartete. Er lud uns ins Café ein. Dort informierte er über seine Stadt, und es entwickelten sich schöne Gespräche in der Runde. Nach dem Eintrag in unsere mitgeführte Dokumentation wurde ein Gruppenfoto vor dem Rathaus gemacht.
Nun kam der Aufstieg über Ittenberg zum Wanderheim Eschelhof. Dieser Anstieg war nochmals eine Schweiß treibende Angelegenheit bei diesen Temperaturen (ca. 27 Grad).
Der Abend im Eschelhof wurde sehr stimmungsvoll und erlebnisreich mit Musik und gemeinsamem Singen von Wanderliedern, begleitet vom Akkordeon und Mundharfe geradezu gefeiert. Für mich war es der, vom Wander- und Naturerlebnis gesehen, der schönste Wandertrag, der so stimmungsvoll und harmonisch endete.
6. Juni 2013, 4. Tag: WH Eschelhof – Backnang – Winnenden
Auch am vierten Wandertag grüßte die Sonne, als wir das Wanderheim Eschelhof in Richtung Backnang verließen. Begleitet und geführt von Wanderfreunden aus Backnang und Winnenden, wanderten wir über Floßhau, Zell, Plattenwald, im Schatten der Murr entlang, vorbei am Freibad, an Fabrikgebäuden und Villen geradewegs zum Rathaus, wo wir von Herrn Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper und dem Gauvorsitzenden des Rems-Murr-Gaus, Roland Luther empfangen wurden. Nach dem offiziellen Pressetermin und Foto vor dem Rathaus informierte Herr Dr. Nopper über seine Stadt Backnang, den Gänselieselbrunnen beim Rathaus und später im historischen Sitzungssaal des Rathauses über einige berühmte Ehrenbürger der Stadt.
Ein wirklich angenehmer, informativer und schöner Aufenthalt im Rathaus von Backnang. Für unseren Besuch und Empfang hatte sich der OB eine ganze Stunde Zeit genommen. Er regte dabei an, eines der nächsten Landesfeste in seiner Stadt abzuhalten und zu feiern.
Gestärkt mit Getränken und Brezeln spazierten wir wiederum an dem Fluss Murr und ehemaligen Lederfabriken entlang zur Mittagseinkehr.
Danach wartete ein Sonderbus, der uns zum Aussichtsturm und -punkt »Galgenberg» brachte. Eine herrliche Aussicht in die nahe und weitere Entfernung – auch zur Schwäbischen Alb mit dem Hohen-Neuffen – lohnte den Aufstieg im Turm.
Auf kurzer Fahrt brachte uns der Bus anschließend zum »Stöckenhof». Dort warteten ca. 30 Wanderfreundinnen und -freunde der Ortsgruppe Winnenden, die die Wanderung unter der Führung von Barbara Baumann, über den Ort Bürg, dem Panoramaweg – wiederum mit herrlicher Aus- und Fernsicht – durch Baach und Hofen geradewegs ins Zentrum von Winnenden, mitmachten. Reinhold Layer, der Vorsitzende der Ortsgruppe Winnenden, erklärte und führte durch die Innenstadt und brachte die große Wandergruppe ins Neue Rathaus zum Empfang im Sitzungssaal mit Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth. Der Weiterweg führte zum Schloss Winnental, durch den schönen Schlosspark zur Schlosskirche mit dem, als Kleinod zu bezeichnenden, ganz in Holz geschnitzten Altar aus der Zeit um 1500.
Nach dem Abendessen im Zentrum von Winnenden spazierten wir zur Übernachtung ins am Stadtrand liegende Hotel.
7. Juni 2013, 5. Tag: Winnenden – Plochingen
Unser fünfter und letzter Wandertag begann mit dem Verladen des Gepäcks in unser Begleitfahrzeug, das uns mit seinem Fahrer Günther Böhm während der Wandertage gute und treue Dienste erwies.
Es war wieder warm, und die Sonne schien, machte also Laune auf die letzten Kilometer. Zuerst fuhren wir in unserem Begleitfahrzeug und einen weiteren Fahrzeug nach Hanweiler und weiter zum Parkplatz unter dem »Korber Kopf», auf den wir anschließend hinaufwanderten und mit einer grandiosen Aussicht belohnt wurden. Mit dem Auto ging’s weiter durch Endersbach, dort kauften wir Vesper und Getränke, nach Strümpfelbach. Hier verließen wir die Autos und wanderten durch das wirklich sehenswerte, mit vielen Fachwerkhäusern gesegnete und gesäumte Weindorf Strümpfelbach.
Den steilen Aufstieg zum Schurwald nach Aichwald-Schanbach überwanden wir ebenfalls in den Autos.
In Schanbach war Mittagspause, bei der wir uns sonnen konnten. Bald warteten die Wanderführer aus Schanbach, die uns durch den Wald über »Schreiershau» und »Saisleshau» zum Ortsteil »Stumpenhof» nach Plochingen brachten.
Nachdem wir ein wenig ausgeruht und uns mit Kaffee, Kuchen und Eis gestärkt hatten, ging es auf den letzten Metern, mit dem Landesfestwimpel an der Spitze, zum Jubiläumsturm, wo wir vom Hauptausschuss des Schwäbischen Albvereins, Herrn Präsident Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß und Herrn Bürgermeister Frank Buß erwartet und freundlich empfangen wurden.
Die Wanderung im Neckartal, durch die Löwensteiner Berge, den Schwäbisch-Frankischen Wald, durch die Backnanger Bucht, das Remstal und hinauf zum Schurwald wurde wieder zu einem vollen Erfolg für das Wandern im und mit dem Schwäbischen Albverein. Die zahlreichen Begegnungen und Gespräche mit vielen Wanderfreunden auf der Strecke gab dem Projekt die Würze und wurde dadurch sehr interessant und erlebnisreich. Ein herrliches Natur- und Landschafts-, auch Kulturerlebnis mit zahlreichen Blumen- und Orchideenwiesen, kleinen Seen, Biotopen, freundlichen und sehr aufgeschlossenen Wanderführern und Menschen, malerischen Dörfern, wunderschönen und sehr informativen Empfängen liegt hinter uns. Dankbar für diesen erlebten ideellen Reichtum kehrten wir wieder in unsere Heimatorte zurück und rüsten uns, laden gleichzeitig für das nächste Jahr ein, wenn wir wieder als »Botschafter des Schwäbischen Albvereins und für das Wandern» von Plochingen in drei Wandertagen nach Reutlingen wandern werden.
Mit herzlichem Dank an alle Wanderführer und Mitglieder des Schwäbischen Albvereins, die zum hervorragenden Gelingen der »Landesfest-Wimpelwanderung 2013» beigetragen haben, endet mein Bericht. Auf ein Neues vom 28. Mai bis 30.Mai 2014!
Eugen Kramer
Präsidium und Gesamtvorstand gewählt
 Bei der Hauptausschusssitzung des Schwäbischen Albvereins am 8. Juni im Rahmen des Landesfestes zum 125-jährigen Jubiläum in Plochingen wurde das Präsidium neu gewählt. Präsident Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß sowie die beiden Vizepräsidenten Reinhard Wolf und Hans-Jörg Schönherr wurden für weitere vier Jahre in ihrem Amt bestätigt. Rolf-Walther Schmid, Vorsitzender des Stuttgarter Gaus, und Manfred Stingel, Kulturratsvorsitzender, wurden als Beisitzer wiedergewählt. Zudem wurden zwei neue Beisitzer, Tanja Waidmann und Rolf Kesenheimer, gewählt.
Bei der Hauptausschusssitzung des Schwäbischen Albvereins am 8. Juni im Rahmen des Landesfestes zum 125-jährigen Jubiläum in Plochingen wurde das Präsidium neu gewählt. Präsident Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß sowie die beiden Vizepräsidenten Reinhard Wolf und Hans-Jörg Schönherr wurden für weitere vier Jahre in ihrem Amt bestätigt. Rolf-Walther Schmid, Vorsitzender des Stuttgarter Gaus, und Manfred Stingel, Kulturratsvorsitzender, wurden als Beisitzer wiedergewählt. Zudem wurden zwei neue Beisitzer, Tanja Waidmann und Rolf Kesenheimer, gewählt.
Im Bild sind alle Mitglieder des Präsidiums und des Gesamtvorstands zu sehen, von links Hauptjugendwart Michael Neudörffer, Vizepräsident Reinhard Wolf, Präsident Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß, Vizepräsident Hans-Jörg Schönherr, Ehrenpräsident Peter Stoll (sitzend), Tanja Waidmann, Manfred Stingel, Rolf Kesenheimer, Rolf-Walther Schmid.
Gedicht und Rede des Landtagspräsidenten Guido Wolf
Landtagspräsident Guido Wolf hielt nicht nur eine Rede beim Landesfest am 9. Juni 2013 in der Stadthalle Plochingen, die wir hier veröffentlichen, er schenkte dem Schwäbischen Albverein auch ein Gedicht:
Bist Du im Herzen, wie mir schien, politisch nicht, nein seelisch grün,
bist heimat- und naturverbunden, du, weil dieselbe oft geschunden,
willst nicht allein, sondern mit andern,du gerne die Natur durchwandern,
willst du in allen Lebensjahren, die Schöpfung achten und bewahren,
nichts andr ́es kann dann besser sein: Werd ́ Mitglied im Schwäbischen Albverein!
Die Gründer des „Schwäbischen Albvereins“ anno 1888 waren wahrscheinlich vieles – aber eines waren sie sicher nicht: Pessimisten! Sie sind Optimisten gewesen, Kulturoptimisten sogar – um sie intellektueller, aber auch treffender zu charakterisieren. Dieser Kulturoptimismus hat 125 Jahre im Original überdauert. Das spüren wir alle. Und „gradheraus“, wie ich halt so bin, bekenne ich unumwunden: Das imponiert mir am „Schwäbische Albverein“ besonders! Schon deshalb fühle ich mich ihm sehr verbunden. Entsprechend gern habe ich es übernommen, auf diesem „Jubiläums-Landesfest“ das Land Baden-Württemberg zu vertreten.
Der Herr Ministerpräsident hat Ihnen ja bereits beim großen Festakt am 4. Mai zum stolzen Jubiläum offiziell gratuliert. Sehen Sie es daher der Landesregierung bitte nach, dass sie heute niemand aus ihren Reihen entsenden konnte. Oder besser: Betrachten Sie es als zusätzliches Zeichen der Wertschätzung, dass Ihnen nunmehr auch der Landtag – die „Erste Staatsgewalt“– verdientermaßen die Reverenz erweist.
Selbst langjährige Mitglieder unter Ihnen werden es freilich noch nicht oft gehört haben, dass ein Politiker den „Schwäbischen Albverein“ würdigt als Manifestation einer optimistischen – genauer: einer kulturoptimistischen – Haltung. Schwarzseherisch und verdrossen zu sein, macht eben mehr her. Es gilt geradezu als Ausweis eines geschärften Verantwortungsbewusstseins. Manche scheinen sich folglich nur dann wohlzufühlen, wenn sie sich unwohl fühlen.
Oder ernsthafter: Die sogenannte Entfremdung des Menschen von Gott, von der Natur, ja von sich selbst – das zählte spätestens seit der Romantik zu den Lieblingsthemen unserer Dichter, Denker und sonstigen Geistesgrößen. Die wenigsten von ihnen fanden jedoch eine vorwärtsgerichtete, lebensbejahende und trotzdem bodenständige Lösung.
Doch die gibt es! Der „Schwäbische Albverein“ steht seit 1888 mustergültig dafür! Er beweist: Technischer Fortschritt und zunehmende zivilisatorische Errungenschaften bedeuten nicht zwangsläufig, dass sich die oder der Einzelne von der Natur verabschieden muss. Es existiert ein hoch wirksames und gleichwohl risikofreies Gegenmittel: eben, sich dem „Schwäbischen Albverein“ anzuschließen! Man muss da nicht seinen Arzt oder Apotheker konsultieren, denn früher zumindest war es für die und alle anderen Honoratioren „Ehrensache“, selber Albvereinsmitglied zu sein.
Auch wenn es ein bißchen brachial klingt: Wer in den „Schwäbischen Albverein“ eintritt, der tritt zugleich eine virtuelle Mauer ein: Er schafft sich faktisch und mental einen Zugang zur Natur; zur Kulturlandschaft; zum Kern dessen, was wir mit dem Begriff „Heimat“ meinen; oder kurz: zu vielem, was wir Menschen außerhalb unserer Familie und außerhalb unserer „vier Wände“ für unser Seelenheil benötigen.
Apropos: Seelenheil. Da dieses „Landesfest“ – wie bei den großen Veranstaltungen des „Schwäbischen Albvereins“ üblich – mit einem ökumenischen Gottesdienst begonnen hat und da mit offenen Augen kundig und achtsam durch unsere Natur zu wandern ein sehr gottgefälliges Tun ist, darf man betonen, dass der „Schwäbische Albverein“ überdies der Entfremdung des Menschen in vertikaler Richtung vorbeugt. Was beinhaltet: Sonntagmorgens mit dem Schwäbischen Albverein auf Tour zu gehen und deshalb den Kirchgang zu „schwänzen“, erhöht nicht die Punktzahl im „da oben“ geführten Sündenregister. Ja, Wandern ist „Beten mit den Füßen“ – weil es den Respekt vor der Schöpfung und vor der eigenen Kultur fördert. Oder profaner, aber dafür mit unserem Landsmann Friedrich Schiller gesagt: „Der gebildete Mensch macht sich die Natur zu seinem Freund.“
Mit der Natur dauerhaft Freundschaft zu schließen, das ist aber – wie jede Art von Bildung – nicht zuletzt eine Frage des Willens. Präziser formuliert: der Willenskraft! Im Grunde müssen wir die erste und zweite Generation der Albvereinsmitglieder bereits deshalb sehr bewundern.
Der „Brockhaus“ von 1913 hat das Stichwort „Freizeit“ nicht gekannt. Trotzdem brachten es Menschen auf die „Reihe“, regelmäßig sonntags Wandern zu gehen, Ortsgruppen des Albvereins aufzubauen, sich dort gesellig zu treffen. Das war zum einen: „Idealismus pur“! Und das war zum anderen: gelebte und praktizierte Freiheit! Wer „zum Albverein“ ging, wer gar dort ein Amt übernahm, der schloss sich einer souveränen Gemeinschaft an – der nutzte seine bürgerliche Freiheit. Im „Albverein“ zu sein – das hatte „was“. In der Selbstwahrnehmung des Einzelnen. Und in den Augen der Mitmenschen.
Übrigens, Stichwort „Bildung“: Damals war es noch selbstverständlich, so elementare Dinge wie den Unterschied zwischen einer Buche und einer Eiche zu kennen. Würde man jetzt in einer PISA-Studie das Wissen über unsere heimischen Wildtiere und Wildpflanzen, über unsere Natur und unsere Landschaften untersuchen, dann kämen wohl eher unerfreuliche Ergebnisse heraus. Trotz der riesigen Informationsmöglichkeiten trocknet die Allgemeinbildung aus! Auch ich freue mich deshalb, dass der „Schwäbische Albverein“ an einer Renaissance des Schulwanderns arbeitet und beim Kultusministerium mit sympathischer Penetranz „bohrt“. Schulwandern nicht als Auszeit vom Lernen, sondern als Eintauchen in die „Welt des Wissens“.
Hinzu kommt: Die Durchblutung unseres Gehirns korrespondiert bekanntlich mit der Durchblutung unserer Waden – und die wird beim Wandern bestens gefördert. In jedem Lebensalter! Das Gesundheitswandern ist eine Chance für den „Schwäbischen Albverein“ – und er hat sie erkannt. Oder frei nach Schiller: Der kluge Wanderverein macht sich den gesellschaftlichen Bedarf zu seinem Freund.
Albvereinsmitglied zu sein, das büßte so vor 40, 45 Jahren – ich sage nicht „1968“ – seinen hohen Rang im kollektiven Empfinden ein. Individualität wurde zur Maßeinheit der Freiheit. Je individueller, je freier – Soziologen nennen das „Entstandardisierung“. Inzwischen wissen wir allerdings: „Entstandardisierung“ ist – anders als die Mitgliedschaft im Albverein – eine „Therapie“ mit erheblichen Risiken und Nebenwirkungen.
Wesentliches erodiert, wenn jeder sein Glück in der Bindungslosigkeit zu schmieden versucht und seine Freiheit möglichst unabhängig von anderen nutzen will.
Diese gesellschaftliche Entwicklung stürzte den „Schwäbischen Albverein“ jedoch – gottlob – nicht in Selbstzweifel. „Wanderwetter ist immer“ – das gilt bei ihm nicht nur meteorologisch, sondern auch in Bezug auf das soziale Klima. Der „Albverein“ blieb sich treu – selbst wenn der „wetterwendische“ Zeitgeist zu einem veritablen Gegenwind wurde. Das heißt: Seit 125 Jahren – und zwar durchgängig – begreift man im „Schwäbischen Albverein“ Freiheit nicht als individualistisches oder gar egoistisches Phänomen. Nein, man vergrößert die eigene Freiheit durch die aktive und bewusste Gemeinschaft! „Chapeau!“
Ursächlich für die irgendwann abnehmende Attraktivität des Wanderns im Verein waren selbstverständlich auch das Wirtschaftswunder und die allgemeine Motorisierung. Das Wandern bekam schlicht mannigfaltige Konkurrenz – und die hatte nicht nur den Reiz des Neuen auf ihrer Seite, sondern auch die Chance, den erarbeiteten persönlichen Wohlstand besser demonstrieren zu können.
Wir alle – zumindest wenn wir vor 1968 geboren worden sind – haben das Volkslied auf den Lippen: „Froh zu sein bedarf es wenig / Und wer froh ist, ist ein König.“ Und tatsächlich: Wer mit einer Ortsgruppe des „Schwäbischen Albvereins“ loswandert, fühlt sich schon nach wenigen Metern wie ein König. Oder wie eine Königin. Allein: Niemand sieht’s.
Keine knapp bekleideten Animateure männlichen oder weiblichen Geschlechts, „nur“ wege- und wirtshauskundige Wanderführer; kein Kitzel von Mode- oder gar Extremsportarten, „nur“ das wache, genießende Durchmessen von Wald und Flur in einem wohltemperierten Tempo – diese vermeintliche Biederkeit war das Problem des Wanderns.
Wohlgemerkt: war! Inzwischen verschafft das Wandern wieder dezidiert Sozialprestige. Aber wenn zwei das Gleiche tun, ist es eben nicht automatisch dasselbe. Auch beim Wandern nicht. In aller Vorsicht gesprochen: Wenn er nicht aufpasst, klebt der „Solo-Trendwanderer“ in jener Rolle fest, die uns permanent, aber mit problematischen Folgen als die höchste Form menschlicher Erfüllung suggeriert wird: die Rolle des Konsumenten. Beim Albverein hingegen wandert immer etwas Spezifisches mit: die Freundschaft – im Sinne Schillers – zur Natur und zur Kultur!
Weniger lyrisch ausgedrückt: Seit 1888 schafft und erhält der „Schwäbische Albverein“ die Voraussetzungen seines Tuns selbst. Er verbraucht nicht, was er nutzt – im Gegenteil: Er sorgt engagiert dafür; ja, er mehrt es! Das moderne Wort „Bürgerbeteiligung“ ist ein viel zu schwacher Begriff für den Impetus des „Schwäbischen Albvereins“. Wo er aktiv ist, geht es all dem, was wir „Heimat“ nennen, besser! Und damit geht es unserem Land besser! Wirklich: Unserer Landschaft, unseren Natur- oder Baudenkmalen, unseren ökologisch hochwertigen Flächen, aber auch unserem Brauchtum oder unserer Mundart kann nichts Segensreicheres passieren, als dass sich der Albverein darum kümmert.
Und: dass er unsere Kinder und Jugendlichen dafür begeistert. Ich finde es großartig, wie er das macht. Zum Beispiel, dass er die Technikaffinität der jungen Generation ohne Berührungsängste aufgreift, also das Analoge und das Digitale in ein wechselseitig fruchtbares Verhältnis bringt. Mit satellitengestütztem GPS „zurück zur Natur“ – das ist cool! „Megacool!“ Und: pädagogisch wertvoll. Da wäre selbst Jean Jacques Rousseau in Wanderschuhen wortwörtlich aus dem Häuschen. Und wahrscheinlich dauert es nicht mehr lange, bis der „Albverein“ als Jahresgabe – statt der traditionellen Wanderkarten – „Wander-Apps“ fürs Smartphone spendiert.
Wie eingangs angedeutet: Könnten die Gründer des „Schwäbischen Albvereins“ zurückkommen, würden sie unseren Alltag und unsere technischen Möglichkeiten ungläubig bestaunen – einschließlich der Hightech-Outdoorkleidung, die es heute gibt. IHREN „Albverein“ jedoch – den würden sie sofort wieder erkennen: am Geist, der dort herrscht! Also an Ihrem Geist, meine Damen und Herren!
Der „Schwäbische Albverein“ erklärte sich zum „Strukturpolitiker“, als es die Wortschöpfung noch gar nicht gab! Und er verschrieb sich der „Symbiose von Ökonomie und Ökologie“ , ohne dass ihm die Begriffe bewusst waren.
Das wiederum bedeutet, und zwar ohne jene Übertreibungen, zu denen man an Jubiläen bisweilen neigt: Es ist in besonderer Weise ein Verdienst des „Schwäbischen Albvereins“, dass wir die „Schwäbische Alb“ heute als ein wirkliches Muster gilt für einen vernünftig austarierten Dreiklang „Schutz durch Nutzung – Schutz mit Nutzung – Schutz vor Nutzung“!
Ja, die Schwäbische Alb hat Karriere gemacht – nicht als ein modernistisches „Freizeitressort“, sondern als „Schwäbische Alb“. Sie war das „Aschenputtel“ unter unseren Landschaften – und der „Schwäbische Albverein“ ist der Königssohn, der sie entdeckt hat. Und das – in Zeiten von RTL und SAT 1 glaubt man es – ganz ohne „Castingshow“ mit Heidi Klum.
UNSER „Biosphärengebiet“ – ich nenne es gerne so: UNSER „Biosphärengebiet“ ist ein Modell, wie sich Natur- und Umweltschutz erfolgreich mit der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung der dort lebenden Menschen verknüpften lässt. Ein strukturpolitisches Meisterstück! Und zu dessen Protagonisten zählte der „Schwäbische Albverein“dankenswerterweise vorbehaltlos und nachdrücklich! Vor allem: Das Projekt wurde in einem breiten Konsens realisiert! Das geschah, indem man vor Ort in unzähligen Gesprächen Konzepte entwickelte. Und die überzeugten – nicht zuletzt wegen des Verfahrens. Ursprünglich sollte das „Biosphärengebiet“ aus dem alten Münsinger Truppenübungsplatz und drei Gemeinden bestehen und 20.000 Hektar groß werden; am Ende beteiligten sich 18 Kommunen mit 85.000 Hektar Fläche. Wir sehen: Auch solche Leuchtturmprojekte lassen sich – von Stuttgart aus angestoßen – verwirklichen.
Aber ich möchte mich nicht in der Tagespolitik verlieren – sondern lieber würdigen, dass der Name „Schwäbischer Albverein“ zu den sympathischsten Untertreibungen gehört, die man sich denken kann.
- „Schwäbischer Albverein“ – das ist erstens mehr als Wandern! Viele seiner Ortsgruppen sind längst mit dem Rad oder auf Ski unterwegs – wohlgemerkt auch da in Freundschaft mit der Natur. Und vor allem: Der Schwäbische Albverein gehört zu unseren Kulturträgern. Man kann es durchaus ohne Krampfhusten in einem Atemzug sagen: In Marbach gibt es das „Deutsche Literaturarchiv und in Balingen- Dürrwangen das Schwäbische Kulturarchiv des Albvereins!
- Der „Schwäbischer Albverein“ – das ist zweitens mehr als „Schwäbische Alb“! Bei aller Wanderlust: Seine Ortsgruppen empfinden die Gemarkung vor der Haustüre als ihr Revier – als ihr „Heimatrevier“, wo sie Erhaltungsaufgaben übernehmen, zum gesellschaftlichen Leben beitragen oder sich an der jährlichen Flurputzete beteiligen.
- Und: „Schwäbischer Albverein“ – das ist drittens mehr als ein Verein – nämlich: seit fast zwanzig Jahren ein anerkannter Naturschutzverband! Genauer ein „Naturschutzverband plus“ – er nimmt diese Funktion nicht lediglich mit Worten wahr; er „schafft“ mit der Hand am Arm.
Die Landespolitik und die Behörden auf allen Ebenen sind dankbar, dass sie im „Schwäbischen Albverein“ einen so exzellenten, tatkräftigen und soliden Partner haben im Naturschutz, beim Landschaftserhalt, im Tourismus und in der kulturellen Heimatpflege.
Wir schätzen am Albverein seine Leidenschaft, seine Zuverlässigkeit, sein Augenmaß und seinen Pragmatismus. Wir betrachten es deshalb überhaupt nicht als Drohung, das er sich stärker politisch einmischen möchte. Im Gegenteil! Denn schon heute ist anerkannt: Wenn der „Schwäbische Albverein“ argumentativ am sperrigsten erscheint, ist er praktisch am wohlmeinendsten.
So lehrt er uns im Prinzip bereits seit 125 Jahren, dass wir nicht trennen dürfen zwischen der Naturlandschaft, die wir hegen und pflegen, und einer Wirtschaftslandschaft, bei der – fälschlicherweise – nur effiziente Nutzbarkeit und bestmögliche Erschließung zählen und an die sonst keine Anforderungen gestellt werden. Und dieses integrierende Verständnis des „Albvereins“ wird immer zielführender.
Keine Frage: Wir brauchen ein effektiveres Flächenmanagement. Diese Einsicht erhält ja durch die verheerenden Flutkatastrophen in Ostdeutschland, in Norddeutschland und in Bayern momentan – hoffentlich auf Dauer – politische Schubkraft. Dazu habe ich einen Zeitungskommentar gelesen, der meines Erachtens den Kern herausschält. Der Autor fragte, warum München eigentlich vom Hochwasser kaum betroffen wurde? Und er zeigte auf, dass zweierlei zusammenwirkte: einerseits ein großer Eingriff in die natürliche Flusswelt: der Sylvensteinspeicher, mit dessen Hilfe sich die Isar regulieren lässt; und andererseits, dass die Isar mit hohem Aufwand renaturiert worden ist und etliches von ihrem angestammten Platz zurückbekommen hat.
Ich bin nur körperlich blauäugig, aber nicht mental – deshalb behaupte ich nicht, dass der Kommentor ein Patentrezept skizziert hat, das man lediglich x-fach kopieren muss. Aber er hat meines Erachtens etwas Zentrales benannt– und das ist: Wir dürfen weder in der einen noch in der anderen Richtung unser Heil fundamentalistisch suchen. Uns muss vielmehr gelingen, den ökologischen Ansatz und die Möglichkeiten des technisch Machbaren optimal zu kombinieren – in praktische Konkordanz zu bringen, wie wir Juristen in solchen Konstellationen sagen. Öko-Purismus ist ebenso falsch wie schiere, einfältige Technikgläubigkeit. Oder um einen anderen klugen Beobachter zu zitieren: „Der moderne Mensch wird es nicht schaffen, Wasser nur noch als sanft plätschernde, computergesteuerte Springbrunnen zu erleben. Das Gegenidyll, in dem wir Flüssen und Seen die alte Freiheit wiedergeben, um fortan in Eintracht mit ihnen zu leben, wird es auch nicht geben – denn dieses Idyll hat es nie gegeben: In Aufzeichnungen aus früheren Jahrhunderten können wir nachlesen, wie grausam die Fluten damals schon zuschlugen.“
Für mich heißt das – in zwei Sätzen gesagt: Wir brauchen dringend eine unideologische Entschlossenheit! Und ich bin sicher: Da haben wir den „Schwäbischen Albverein“ an unserer Seite!
Es gilt also mehr denn je – und ich sag ́s noch einmal angelehnt an Schiller: Der verantwortungsvolle Politiker macht sich den „Schwäbischen Albverein“ zu seinem Freund. In diesem Sinn begleiten Sie meine besten Wünsche bei all Ihren Aktivitäten, insbesondere natürlich auf Ihren Wanderungen.
Meine guten Wünsche sind sozusagen ein mentaler Proviant, der Ihre Rucksäcke nicht beschwert, von dem Sie allerdings auch nicht herunterbeißen können. Ich hoffe aber, dass Sie meine optimistische – ja, kulturoptimistische – Verbundenheit trotzdem stärkt – und vor allem: bestärkt in Ihrem Bekenntnis für den „Schwäbischen Albverein“! Sie sind nicht nur Mitglieder des zahlenmäßig größten Wandervereins in Europa – Sie sind Mitglieder eines wirklich großen Vereins!
Ansprachen Jahreshauptversammlung 2013
Stadthalle Plochingen, 9. Juni 2013
Ansprache des Landrats Heinz Eininger
Sehr geehrter Herr Landtagspräsident Guido Wolf,
sehr geehrte Herren Abgeordnete,
sehr geehrter Herr Präsident Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß,
sehr geehrte Präsidenten anderer Verbände,
sehr geehrter Herr Gauvorsitzender Hempel,
sehr geehrte Mitglieder und Freunde des Schwäbischen Albvereins,
verehrte Festversammlung,
„SAV is coming home“, würde man in der Fußballsprache sagen, wenn man das umschreiben will, was hier und heute geschieht. Wir alle kommen – fast auf den Tag und fast auf den Ort genau – zusammen, um im Rahmen der Jahreshauptversammlung und des Landesfestes 2013 das Jubiläum zum 125jährigen Bestehen des Schwäbischen Albvereins zu begehen. Was damals das Gasthaus zum „Waldhorn“ in Plochingen war, ist für uns heute die Stadthalle und statt 12 Männern sitzen wir heute in deutlich größerer Runde beisammen.
Als Landrat des Landkreises Esslingen bin ich fast ein wenig stolz darauf, dass die Wiege des größten europäischen Wandervereins hier bei uns mitten im Landkreis liegt; wohl wissend, dass ich mich dabei ein klein wenig mit fremden Federn schmücke.
125 Jahre sind eine lange Zeit, in der sich der Schwäbische Albverein nicht nur bewährt, sondern kontinuierlich weiter entwickelt hat. Ich möchte sogar behaupten, dass der Schwäbische Albverein einer der „komplettesten“ Vereine überhaupt ist. Sie haben eine Bandbreite an Themenfeldern und Menschengruppen, die auch auf internationaler Bühne ihresgleichen sucht. Aus dem Zusammenschluss von sieben örtlichen Verschönerungsvereinen wurde sehr rasch ein aktiver Wanderverein, der sich Stück für Stück die gesamte Schwäbische Alb erschloss.
Und wenn ich ihr heutiges Spektrum betrachte, bin ich jedes Mal wieder beeindruckt, in wie vielen Bereichen des heutigen Lebens Sie Aktivitäten entfalten.
– Sie haben sich der Gesundheitsförderung verschrieben,
– sind überaus aktiv in der Bewahrung und Pflege unserer Natur,
– Sie sind vielfältig in der Bewahrung unseres kulturellen Erbes unterwegs,
– wenden sich an die ganze Familie und alles Altersgruppen, vom Kinderwagen bis zur Gehhilfe und
– betreiben eine eigene Heimat- und Wanderakademie.
Ihnen und Ihren vielen, vielen Mitgliedern gelingt es tagtäglich, Tradition und Brauchtum lebendig zu halten und in die heutige Zeit zu überführen. Wie heißt es so schön: „Traditionen sind wie Straßenlaternen; sie leuchten den Weg aus. Nur Betrunkene halten sich an ihnen fest.“
Mit Ihrem vielfältigen Engagement tun Sie genau dies. Sie bewahren die Traditionen ohne ihr die Käseglocke historischer Verklärung überzustülpen. Sie sind Heimat für Wander-, Natur- und Kulturliebhaber aller Altersgruppen. Hierzu gratuliere ich Ihnen ganz besonders und danke Ihnen für Ihr großes Engagement.
Seit der Vereinsgründung hat sich vieles verändert. Wenn man in Ihrem äußerst gelungenen Buch zur 125-jährigen Vereinsgeschichte die historische Aufnahme des Jubiläumsturms in Plochingen aus dem Jahr 1938 betrachtet, stellt man fest, dass unsere hiesige Landschaft im Neckartal im Lauf der Jahre sehr viel an Freiflächen, Vielfalt und Natürlichkeit eingebüßt hat. Gerade hier, vor unserer Haustür, wurde die Landschaft sehr stark durch die Wirtschaft/Industrie und die entsprechende Infrastruktur geprägt.
Bei genauerem Hinschauen kann man jedoch auch feststellen, dass sich die Städte und Gemeinden dennoch ihren Charme und auch ihre landschaftlichen Reize erhalten haben. Wir alle können uns jederzeit die Schönheit der Umgebung und auch die historischen und kulturellen Reize der Stadt Plochingen erwandern und bei einem Blick vom Jubiläumsturm des Jahres 1938 unseren Blick über die weitere Landschaft schweifen lassen. Jeder, der das tut, wird feststellen, dass wir hier im Landkreis Esslingen auf einem besonders attraktiven Fleckchen Erde mit einem hohen Freizeit- und Erholungswert leben dürfen.
Noch attraktiver und geradezu atemberaubend ist die Natur und die Landschaft oben auf der Alb und insbesondere an der Albkante entlang. Der Albtrauf von Weilheim bis Kohlberg ist landschaftlich eines der reizvollsten Gebiete im ganzen Land. Hier erstreckt sich der Blick weit ins Tal und auf die im Albvorland gelegenen Streuobstwiesen. Gerade im Frühjahr ist dies eines der genussvollsten Erlebnisse, die ich mir vorstellen kann.
Mit hochattraktiven Wanderwegen, herrlichen Aussichtspunkten, der Burg Hohenneuffen und insbesondere mit dem Albvereins-Wanderheim auf der Teck haben wir ganz besondere Filetstücke im Landkreis. Nicht umsonst wurde der Alb-Nordrand-Weg (Hauptwanderweg 1) im Jahr 2009 als „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ prämiert. Nun ist 2012 ein weiteres Prädikat dazugekommen: Der HW 1 ist einer von 14 „Top Trails of Germany“. Auch wenn das nicht gerade ein ur-schwäbischer Ausdruck ist, möchte ich sogar behaupten: Die Strecke in unserem Landkreis ist mit das Schönste was der Alb-Nordrand-Weg zu bieten hat.
Wir im Landkreis Esslingen dürfen auf eine jahrzehntelange bewährte und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen, dem Schwäbischen Albverein und seinen Ortsgruppen zurückblicken. Gerade in den letzten Jahren hat sich diese Zusammenarbeit im Zuge der Ausweisung des Biosphärengebiets Schwäbische Alb nochmals intensiviert. Bei den Vorbereitungen zur Anerkennung nach Baden-Württembergischen Landesrecht, aber vor allem bei der anschließenden Anerkennung des Biosphärengebiets durch die UNESCO im Jahr 2009, haben Sie uns großartig unterstützt. Ihr Wanderwegenetz, Ihre örtlichen Kenntnisse und Ihre Einrichtungen, wie Aussichtstürme oder Wanderheime, gehören zu den Fundamenten eines nachhaltigen Erfolgs des Biosphärengebiets.
Gemeinsam ist es uns dabei unter anderem auch gelungen, die historischen Wanderwege, die heute durch Kernzonen des Biosphärengebiets führen, zu erhalten. Gerade auch in Fragen der zuverlässigen und benutzerfreundlichen Wege-Ausschilderung haben wir gerne auf Ihre jahrzehntelange Erfahrung zurückgegriffen. Auch hierfür gilt Ihnen mein ganz herzlicher Dank.
Sie und Ihre Mitglieder sind aber nicht nur engagierte Wanderer, Sie packen auch richtig zu, wenn es um den praktizierten Naturschutz geht. Nur beispielhaft möchte ich hier die Betreuung und Pflege von Naturdenkmalen und Naturschutzgebieten, wie das Schopflocher Torfmoor oder das Randecker Maar, Neuffener Heide nennen. Diese gemeinsamen Aktionen von Schwäbischem Albverein und Landkreis sind Ausdruck unseres gemeinschaftlichen Ziels, unsere wunderschöne Heimat für uns und für unsere Kinder und Enkel zu erhalten.
Ihnen allen, den Mitgliedern und Vorständen in den Ortsgruppe, den Kreisverbänden und dem „großen“ Schwäbischen Albverein danke ich für Ihr großartiges und vielfältiges Engagement und für die gute Zusammenarbeit.
Der heutigen Jahreshauptversammlung wünsche ich einen guten und harmonischen Verlauf sowie Ihnen und Ihren Familien noch ein erlebnisreiches Landesfest 2013.
Bericht des Hauptjugendwarts Michael Neudörffer
Sehr geehrter Herr Landtagspräsident Wolf,
sehr geehrter Herr Landtagsvizepräsident Drexler,
sehr geehrter Herr Bürgermeister Buß,
sehr geehrter Herr Präsident,
sehr geehrte Ehrengäste,
liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde,
es ist mir eine Ehre, in diesem so besonderen Jahr hier in Plochingen als Hauptjugendwart vor Ihnen stehen zu dürfen. Nachdem mein letzter Bericht bei Ihnen für erhöhte Aufmerksamkeit sorgte, so hoffe ich nun, erhalte ich auch dieses Mal erneut Ihre volle Aufmerksamkeit, denn viel hat sich getan, seit ich das letzte Mal an dieser Stelle stand. Und auch in Zukunft werden wir mit dem Feuer der Begeisterung, das in uns brennt und unser aller ehrenamtlicher Engagement möglich macht, viel bewegen.
Zunächst kann ich Ihnen jedoch berichten, dass unsere Freizeiten und Zeltlager sich gut entwickeln und wir dabei noch höhere Teilnehmerzahlen zu verzeichnen haben als im vergangenen Jahr. Insbesondere freut mich, dass sowohl unsere jungen Freizeiten deutlich an Teilnehmern gewonnen haben, als auch unsere etablierten Zeltlager steigende Teilnehmerzahlen präsentieren.
Dies alles ist ein Beweis dafür, dass wir nicht nur eine gute Arbeit machen, sondern vor allem ein gutes Programm bieten. Dieses orientiert sich an unseren vier Leitbildern – zwischen Tradition und Moderne, Natur- und Umweltschutz, Soziales und demokratisches Handeln sowie Gemeinsam unterwegs.
Möglich ist dies alles nur, weil sich zahlreiche junge Menschen, in ihrer Freizeit, neben Schule, Studium und Beruf, bei uns engagieren, um anderen eine schöne „freie Zeit“ zu bereiten.
Es begeistert mich immer wieder zu sehen, wie leidenschaftlich motiviert unsere jungen Ehrenamtlichen, gleich welchen Alters, sind und sich ihrer Sache annehmen und wie viel Herzblut hier hineingesteckt wird.
Diesem Feuer, das in uns brennt, werden wir uns im kommenden Jahr widmen. Deshalb rufen wir 2014 das Jahr der Zusammenarbeit aus.
Denn Spiel, Spaß und Spannung entsteht bloß dort, wo wir gemeinsam und nicht alleine mit anderen zusammen sind, uns zusammentun und etwas bewegen, an dem wir Freude haben. In diesem Sinne möchten wir 2014 das Feuer in uns mit anderen teilen und weitergeben. Zu allen vier Zeiten des Jahres werden wir die Zusammenarbeit im Schwäbischen Albverein, der Schwäbischen Albvereinsjugend und mit anderen Vereinen und Organisationen suchen.
In Wort, Bild und Tat werden wir 2014 mehr denn je mit anderen die Zusammenarbeit, das Feuer das uns verbindet, suchen. Mit den Familien im Schwäbischen Albverein werden wir eine gemeinsame Vertreter- und Ausschusssitzung veranstalten und das gesamte Jahr über gemeinsame Vor-Ort Treffen in den Regionen abhalten, bei denen wir uns Ihnen vorstellen und zur Zusammenarbeit, zum gemeinsamen Tun anstiften möchten und Sie unterstützen.
Den Höhepunkt des nächsten Jahres wird im Sommer ein gemeinsames Wochenende mit der Jugend im Schwarzwaldverein auf dem FuchsFarmFestival bilden, zu dem wir unsere badischen Freundinnen und Freunde einladen.
Wenn im Herbst dann schließlich alle Freizeiten und Zeltlager vorüber sind, werden wir erstmals ein gemeinsames Wochenende aller auf unseren Freizeiten und Zeltlagern engagierten Ehrenamtlichen veranstalten.
Einstimmen auf das kommende Jahr werden wir uns bereits in diesem Jahr. In den nächsten Monaten werden wir Ihnen zunächst unsere Tätigkeit und vor allem die unserer Jugend- und Familiengeschäftsstelle sowie anschließend die Deutsche Wanderjugend vorstellen und damit unsere Möglichkeiten und Angebote der Zusammenarbeit in den Fokus rücken.
Weiter bringen wollen wir im Jahr der Zusammenarbeit auch das Thema Inklusion. Inklusion geht neben der Integration davon aus, dass jeder Mensch als Individuum etwas Besonderes ist und individuell behandelt werden muss, und so Begriffe wie „normal“, „behindert“ oder „Migrant“ keine Bedeutung haben. Unsere Gedanken hierzu sind aus dem Leitbild „Alle sind willkommen“ der Deutschen Wanderjugend heraus gewachsen.
Bereits auf unserer Frühjahrsvertreterversammlung in diesem Jahr haben wir hierzu erste Meinungen gesammelt und mögliche Ziele benannt, die wir 2014 und darüber hinaus, zusammen mit der Deutschen Wanderjugend, umsetzen wollen.
Zu den leichter umsetzbaren Zielen gehört es zum Beispiel, Berichte in leichter Sprache zu schreiben und bei unseren Veröffentlichungen, speziell dem Jahresprogramm, neben Sprache auch Symbole einzusetzen. Für die Zukunft wollen wir jedoch vor allem Anforderungen wie auch unsere Möglichkeiten identifizieren. Das Jahr der Zusammenarbeit wird hierfür ein Auftakt sein.
Ein dritter Schwerpunkt, den wir auch bereits in diesem Jahr verfolgen, sind gut ausgebildete Ehrenamtliche. Auch im kommenden Jahr wird uns dieses Thema durch das Jahr der Zusammenarbeit begleiten. Als Anbieter von Kinder- und Jugenfreizeiten, Zeltlagern und zahlreichen Veranstaltungen das gesamte Jahr über haben wir sowohl den Teilnehmern als auch den bei uns ehrenamtlich Aktiven gegenüber eine große Verantwortung, unsere Angebote professionell durchzuführen wie auch alle Beteiligten in die Lage zu versetzen, dies zu tun – ganz entsprechend unserer Leitbilder.
Unser Ziel muss daher sein, bei uns eine natürliche Kultur der Fort- und Weiterbildung zu implementieren, so wie dies mittlerweile auch im Berufsleben selbstverständlich ist. Insbesondere bei unseren Freizeitmitarbeitern wollen wir eine deutliche Steigerung der JuLeiCa-Inhaber als Qualifikationsmerkmal erreichen, um unserem Anspruch „die Freizeitprofis“ zu sein, weiterhin gerecht zu werden. Erreichen wollen wir dies durch ein weiterhin attraktives, vielfältiges Lehrgangsangebot einerseits und Werbung hierfür andererseits. So haben wir die letzte Winterausgabe unserer Zeitschrift „Stufe“ diesem Thema gewidmet.
Verantwortung übernehmen wir jedoch nicht bloß dann, wenn wir Freizeiten oder Veranstaltungen durchführen, sondern müssen dies noch viel stärker dann tun, wenn etwas schief gegangen ist. In der Vergangenheit haben wir, gemeinsam mit der Deutschen Wanderjugend, das Konzept „Fair. Stark. Miteinander.“ entwickelt, das sich mit richtigem Verhalten, aber auch mit den Folgen falschen Verhaltens beschäftigt. Ein Abschluss unserer Entwicklung dieses Themas stellt die Ausbildung neutraler Vertrauenspersonen im November diesen Jahres gemeinsam mit dem Landesverband Nordrhein-Westfalen dar. Hier wollen wir Werkzeuge und Methoden entwickeln, wenn’s zu spät ist, als auch unsere leitenden Mitarbeiter sensibilisieren, damit es soweit nicht kommt.
Wir werden damit unserer Verantwortung unseren uns anvertrauten Teilnehmern und Aktiven gegenüber gerecht und gehen schon weit im Voraus Schritte, damit es bei uns nicht zu Mißbrauchsfällen kommt. Gerade als Jugend ist dies wichtig, diese gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und nicht von sich wegzuschieben!
Zurückblickend in die Gegenwart, vielmehr hieraus jedoch auf die Zukunft, möchte ich auf den Umbau des Jugendzentrums Fuchsfarm auf dem Raichberg bei Albstadt-Onstmettingen hinweisen. Nach Monaten des Umbaus, in denen jede Menge ehrenamtlicher wie handwerklicher Zeit und Engagement investiert wurden, konnte der Umbau in diesem Jahr nun zum Abschluss gebracht werden.
Dabei wurde die Fuchsfarm nach über 30 Jahren seit der letzten Modernisierung wieder unter energetischen, sanitären und sicherheitstechnischen Aspekten generalüberholt, so dass sich Teilnehmer, Gäste und Aktive stets wohlfühlen. Damit kann die Fuchsfarm auch für die nächsten 30 Jahre unser Ort für Freizeiten, Lehrgänge und Veranstaltungen, für das FuchsFarmFestival, Jugendbeiratswahlen und unsere größten Zeltlager sein.
Feiern wollen wir die Wiedereröffnung während unseres FuchsFarmFestivals unter dem Motto „Bei uns hat es geklappt – FuFaFe 21“.
In diesem Sinne – bei uns hat es geklappt – beende ich meinen Bericht von der Schwäbischen Albvereinsjugend, nicht jedoch ohne mich vorher bedankt zu haben.
Zunächst möchte ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit während meiner Ausführungen bedanken.
Vor allem bedanken möchte ich mich in diesem Jahr, neben allen ehrenamtlich Aktiven, die uns nicht nur ein schönes Landesfest bescheren, sondern die, gleich in welcher Funktion ob als Jugendleiter, Gaujugendwart, Freizeitleiter- oder Mitarbeiter unseren Verein zu dem machen, was er nach 125 Jahren immer noch ist – ein buntes Abbild der Gesellschaft unseres Landes, unserer Kultur und Heimat, bei all denjenigen, die unglaublich viel Zeit, Arbeit, Nerven und Kraft in die Modernisierung der Fuchsfarm investiert haben. Das Feuer, das in uns brennt und uns antreibt, hat sich sehr deutlich auch in den Leistungen die hier vollbracht wurden gezeigt! Ihnen allen gilt daher mein Dank zu dieser Leistung!
Auch bedanken möchte ich mich, vor allem nach den gestern durchgeführten Wahlen in Vorstand und Präsidium bei Ihnen, Herr Dr. Rauchfuß, sowie dem gesamten Vorstand für das mir entgegengebrachte Vertrauen, die Zusammenarbeit und die jederzeitige Unterstützung in allen Bereichen meiner Arbeit, sei es rund um die Geschäftsstelle oder insbesondere die Modernisierung der Fuchsfarm. Ohne Ihre Bereitschaft zur Durchführung und Ihr finanzielles Engagement, wäre eine solche Modernisierung nicht möglich gewesen.
Uns allen wünsche ich ein schönes Landesfest in Plochingen an dieser historischen Stelle.
Jahreshauptversammlung 2013
Die Jahreshauptversammlung 2013 des Schwäbischen Albvereins fand am 9. Juni 2013 in der Stadthalle in Plochingen statt.
Begrüßung und Bericht des Präsidenten
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
sehr geehrte Ehrengäste,
liebe Ehrenmitglieder,
liebe Wanderfreundinnen, liebe Wanderfreunde,
nachdem die Stadtkapelle Plochingen unter der Leitung von Robert Braininger uns musikalisch begrüßt hat, darf ich Sie zur Hauptversammlung 2013 des Schwäbischen Albvereins in der Stadthalle Plochingen sehr herzlich willkommen heißen.
Viele Ehrengäste sind unserer Einladung gefolgt und heute nach Plochingen gekommen.
An erster Stelle begrüße ich den Präsidenten des Landtages von Baden-Württemberg Herrn Guido Wolf. Es ist für uns eine besondere Ehre, dass Sie heute nach Plochingen gekommen sind und an unsrer Hauptversammlung teilnehmen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, des weiteren möchte ich noch weitere Ehrengäste namentlich begrüßen. Wer von den Anwesenden an unseren letzten Hauptversammlungen teilgenommen hat, kennt den nun folgenden Satz. In Anbetracht der Tatsache, dass wir viele Ehrengäste haben, bitte ich Sie alle, Ihren Willkommensbeifall bis zum Ende der Namensnennungen aufzusparen.
Ich begrüße
Herrn stv. Landtagspräsidenten Wolfgang Drexler,
Herrn Bundestagsabgeordneten Markus Grübel,
Herrn Landtagsabgeordneten Andreas Deuschle,
Frau Ministerialdirigentin Frömke vom Kultusministerium,
Herrn Landrat Eininger,
den Hausherrn Herrn Bürgermeister Buß,
meine Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates der Stadt Plochingen,
Herrn Hafendirektor Weiß,
Herrn stellvertr. Vorsitzenden Dietz vom Landesnaturschutzverband,
Frau Vorsitzende Dr. Dahlbender vom BUND,
Herrn Vorsitzenden Grytz von den Naturfreunden,
Herrn Vorsitzenden Frank von der AG Sing-, Tanz- und Spielkreise,
Herrn Vorsitzenden Griesinger vom Schwäbischen Heimatbund,
Herrn Vorsitzenden Dr. Keller vom AKPV,
Herrn Vizepräsident Aloys Steppuhn von der Europäischen Wandervereinigung,
Herrn Vorsitzenden Buck vom Mährisch-Schlesischen Sudentengebirgsverein,
Herrn Reinelt, Vorstandsmitglied des Deutschen Wanderverbands und Ehrenvorsitzender des Mährisch-Schlesischen Sudetengebirgsvereins,
Von unseren zahlreichen Sponsoren begrüße ich
Herrn Scholz von der Kreissparkasse,
Herrn Schmelzle von der Volksbank Plochingen
als letzten namentlich, aber umso herzlicher, begrüße ich unseren lieben Ehrenpräsident Peter Stoll.
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich heiße Sie alle, auch die namentlich nicht Genannten, sehr herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie den Weg nach Plochingen gefunden haben. Ihr Kommen ehrt unseren Verein, zeigt Ihr Interesse und Ihre Verbundenheit zum größten europäischen Wanderverein.
Ich erkläre hiermit die Hauptversammlung 2013 des Schwäbischen Albvereins in Plochingen für eröffnet.
Die Einladung zur heutigen Versammlung erfolgte satzungsgemäß in den Blättern des Schwäbischen Albvereins Heft Nr. 1 / 2013 vom 1. März 2013.
13. August 1888, ein Datum, das für den Schwäbischen Albverein eine besondere Bedeutung hat. Der Esslinger Arzt und Vorsitzende des Verschönerungsvereins Esslingen hatte für diesen Tag zu einem Treffen nach Plochingen eingeladen. Der Gründungstag unseres Vereins. Vor 25 Jahren traf sich hier die große Vereinsfamilie zu einer Hauptversammlung, um das 100-jährige Jubiläum zu feiern. Heute sind wir wieder an den Gründungsort gekommen, um erneut ein Jubiläum zu feiern.
Seit gestern beleben unsere Gäste aus Nah und Fern und unsere Mitglieder die Stadt. Ein buntes und fröhliches Treiben, Tanzen und Musizieren findet an vielen Plätzen statt. Als Plochinger Stadtrat hoffe ich, dass Sie sich hier wohl fühlen. Für die herzliche Gastfreundschaft danke ich Ihnen, Herrn Bürgermeister Buß, der Stadt Plochingen und der Bevölkerung im Namen aller Teilnehmer sehr herzlich.
Bevor ich es vergessen sollte, möchte ich an dieser Stelle auch allen danken, die an der Vorbereitung und Durchführung unseres großen Landesfestes beteiligt sind, dem Esslinger Gau mit dem Gauvorsitzenden Uli Hempel, der OG Plochingen unter der Leitung von Dieter Weiss und allen beteiligten Ortsgruppen. Außerdem bedanke ich mich bei den Sponsoren, die durch ihre großzügige finanzielle Unterstützung dieses Fest ermöglichen.
Selbstverständlich bedanke ich mich auch bei meiner Stadtkapelle Plochingen für die musikalische Umrahmung unserer Hauptversammlung. Ich freue mich jetzt schon auf den nach dieser Versammlung stattfindenden Festzug. Gerne erinnere ich mich an viele Festzüge, an denen ich als Vorsitzender des Musikvereins Stadtkapelle mit marschiert bin. So wie ich damals stolz auf meine Stadtkapelle war, so bin ich auch heute noch als Ehrenvorsitzender stolz auf Euch.
Wie es für einen Wanderverein üblich ist, sind auch heute wieder sehr viele Wanderfreundinnen und Wanderfreunde angewandert, manche sogar mehrere Tage lang.
Der Vorsitzende der OG Bad Urach Eugen Kramer hatte beim Landesfest 2010 in Bad Urach einen Wanderwimpel gestiftet als Symbol für die Landesfest-Wimpelwanderungen von einem Landesfest zum anderen. In fünf Etappen ist er mit einer Schar Wanderfreunden von Bad Friedrichshall nach Plochingen gewandert und hat den Wanderwimpel mitgebracht.
Von den angewanderten Gruppen sind mir folgende mitgeteilt worden:
OG Bitz, Gundelfingen, Backnang, Gemmrigheim, Steinheim/Murr, Schwaikheim; vom Donau-Bussen-Gau ist eine Fahrradgruppe angereist.
Falls ich eine Gruppe vergessen haben sollte, bitte ich um Vergebung.
Ich wünsche uns allen eine schöne Hauptversammlung, viele gute Begegnungen und interessante Erlebnisse beim Landesfest 2013 des Schwäbischen Albvereins.
Bericht des Präsidenten
Sehr geehrte Ehrengäste,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde,
zu Beginn meines Berichtes darf ich Sie bitten, sich zu Ehren unserer verstorbenen Mitglieder von Ihren Plätzen zu erheben. Eine große Anzahl unserer Wanderfreundinnen und Wanderfreunde haben seit der letzten Hauptversammlung in Bad Friedrichshall ihre letzte Wanderung angetreten. Wir danken unseren verstorbenen Mitgliedern dafür, dass wir ihre Weggefährten sein durften. Den Angehörigen sprechen wir unser Mitgefühl aus. Wir werden das Andenken der Verstorbenen in Ehren bewahren.
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
heute gebe ich meinen 12. Bericht in einer Hauptversammlung des Schwäbischen Albvereins ab. Die heutige Versammlung unterscheidet sich von den vorausgegangenen dadurch, dass wir 125-jähriges Jubiläum feiern und dass für den Vorstand eine vierjährige Amtszeit zu Ende gegangen ist. Mein Bericht wird einen Überblick über die letzten vier Jahre geben. Dieser Zeitraum war geprägt durch die Vorbereitung auf das Jubiläum, durch die Sanierungen unserer Häuser – Erfüllung von Pflichtaufgaben wegen neuer Vorschriften und Auflagen, durch Weiterentwicklung unserer Angebote und durch Intensivierung der Betreuung unserer Gaue und Ortsgruppen.
Der aufwändigste Teil der Jubiläumsvorbereitungen war die Sanierung unserer Hauptgeschäftsstelle. Die Natursteinfassade musste ersetzt werden, da sie im Laufe der Zeit bröselig geworden ist und einzelne Teile drohten, auf den Gehweg zu fallen. Die Außenwände und das Dach wurden mit Wärmedämmung versehen. Die Fenster, der Eingangsbereich, die Haustüre und das Treppenhaus wurden komplett erneuert. Der Verkaufsraum wurde vergrößert und zu einem modernen Empfangs-, Informations- und Verkaufsbereich umgewandelt. Gleichfalls wurde im Erdgeschoss ein Wartebereich eingerichtet. Ein positiver Effekt des Umbaus ist, dass wir jetzt ca. 40 % weniger Energie benötigen. Die CO2- Einsparung ist auch sehr beträchtlich.
Der wohl emotionalste Teil der Jubiläumsvorbereitung war die Erneuerung unseres Erscheinungsbildes, insbesondere das neue Logo. Lebhafte Diskussionen wurden geführt. Nicht jeder war mit der Auswahl einverstanden. Das Präsidium und der Vorstand haben die ihnen übertragene Verantwortung sehr ernst genommen und Entscheidungen getroffen, die nicht unbedingt von allen akzeptiert worden sind. In der Zwischenzeit findet unser neues Logo weitestgehend Zuspruch, sowohl von den Mitgliedern als auch von Nichtmitgliedern.
Der Internetauftritt wurde überarbeitet und hat zum Jahreswechsel ein neues Aussehen erhalten. Die Veranstaltungen sind übersichtlich dargestellt und jeder Besucher findet sich schneller zurecht.
Frau Dr. Walter und Vizepräsident Wolf haben eine inhaltliche Struktur für ein Jubiläumsbuch entwickelt, viele Persönlichkeiten motiviert, Grußworte zu schreiben, einige Autoren beauftragt, Fachbeiträge zu schreiben, und selber auch eigene Kapitel dem Werk beigefügt. Dieses Buch gibt einen flüssig zu lesenden Überblick über die geschichtliche Entwicklung unseres Vereins. Es beschreibt eindrucksvoll die vielfältigen Aufgaben, mit denen wir uns beschäftigen. Das Buch bleibt nicht beim Heute stehen, sondern gibt einen Ausblick in die Zukunft. Den beiden spreche ich großes Lob aus und danke ihnen für ein sehr gelungenes Jubiläumsbuch. Ich kann nur jedem empfehlen, dieses Buch zu kaufen. Der Subskriptionspreis beträgt 9,90 €. Für die Teilnehmer der heutigen Hauptversammlung biete ich eine einmalige Gelegenheit, das Buch zusammen mit einer neuen Jubiläumsbaumwolltragetasche zu einem Sonderpreis von 10,00 €. Dieser Preis gilt nur im Foyer der Stadthalle.
Im letzten Monat fanden in den Gauen Sternwandertreffen statt. Diese Treffen habe ich angeregt, weil mir die Außenwirkung solcher Veranstaltungen für die Werbung des Albvereins wichtig ist und weil bei solchen gauweiten Ortsgruppen übergreifenden Treffen das Zusammengehörigkeitsgefühl verbessert werden kann. Mir ist es wichtig, unsere Mitglieder erleben zu lassen, dass sie alle gemeinsam einem großen Verein angehören.
Neben der Vorbereitung des Jubiläums gab es viele Pflichtaufgaben zu erledigen. Das Wanderheim Eschelhof musste noch an die Kanalisation angeschlossen werden. Das Pfannentalhaus erhielt eine Kleinkläranlage. Die Heizung des Nägelehauses wurde durch ein gasbetriebenes Blockheizkraftwerk ersetzt. Als verantwortungsvoller Naturschutzverband spricht der Schwäbische Albverein nicht nur von Klimaschutz, sondern betreibt selber aktive Energieeinsparung und CO2-Reduktion. Durch den Austausch können wir jährlich über 20 Tonnen CO2 einsparen.
Des Weiteren musste in zahlreichen Wanderheimen der Brandschutz verbessert werden, Zweite Fluchtwege errichtet werden, Brandmeldeanlagen den neuesten Vorschriften angepasst werden, Sicherheitstüren eingebaut werden.
Zu allem Überfluss ist noch die ehemalige Ostbastion des Wanderheimes Burg Teck durch einen Mauerabsturz beschädigt. Denkmalschutz und Archäologie haben uns gezwungen, durch eine aufwändige Umhüllung die zu Tage getretenen Fundamente für die Nachwelt zu konservieren. Diese Arbeiten sind jetzt abgeschlossen.
Erst kürzlich wurde das Hauptgebäude der Fuchsfarm saniert. Der Betreuungsverein und sehr viele fleißige Helfer haben gemeinsam mit Fachhandwerkern den Umbau gestemmt. Die Waschräume wurden umfassend erneuert. Die Heizung wurde ausgetauscht und die gesamte Beheizung des Gebäudes auf den neuesten Stand gebracht. Der Brandschutz wurde grundlegend verbessert. Die Sanierung wurde deutlich teurer als ursprünglich geplant. Zahlreiche Spenden haben den Umbau ermöglicht. An dieser Stelle danke ich allen fleißigen Helfern und den Spendern für ihre Mithilfe und Unterstützung. Sie haben es ermöglicht, dass dieser Umbau gemacht werden konnte. Allerdings besteht noch eine Finanzierungslücke. Deshalb möchte ich nochmals um Spenden bitten.
Inzwischen haben schon wieder einige Freizeiten in unserem Jugend- und Familienzentrum stattgefunden. Die offizielle Einweihung bzw. Wiedereröffnung wird am 6. Juli 2013 gefeiert.
Das letzte Jahr war als Familienaktionsjahr ausgerufen worden. Aus Sicht der Akteure waren die Familienaktionen ein voller Erfolg. Viele Presseberichte über die sehr gut besuchten Veranstaltungen sind erschienen. Über 150 Rückmeldebögen gaben Auskunft über die unterschiedlichsten Aktionen. Ob Käseseminar, Märchenerzählungen, Wanderungen mit Tieren oder eine Fahrt mit einer Draisine, für jeden Geschmack war etwas dabei. Auch viele naturkundliche Wanderungen wurden angeboten. Ein besonderer Höhepunkt war der Auftritt der Mundartband „Wendrsonn“ beim Landesfest in Bad Friedrichshall. Die Band hat extra für die Familiengruppen ein Lied komponiert. Die zahlreichen Zuhörer waren bei der Uraufführung des Liedes „Lust auf Abenteuer“ begeistert.
Ich bin der Meinung, dass das Aktionsjahr keine Eintagsfliege sein darf. Familienaktionen müssen ständig angeboten werden. Bisher zögernde Ortsgruppen müssen motiviert werden, Familiengruppen zu gründen. Ich appelliere an alle OGn, für junge Familien eine neue Heimat an zu bieten. Wir müssen für die weitere Existenz des Schwäbischen Albvereins neue Mitglieder gewinnen. Wir werden alle älter. Für niemanden wird die Zeit angehalten. Wir müssen heute Sorge dafür tragen, dass wir auch in 20 Jahren lebensfähige OGn haben werden.
Neu in das Angebot des Schwäbischen Albvereins werden Gesundheitswanderungen aufgenommen. Gesundheitswandern ist ein tolles Bewegungsprogramm, das Wandern, Naturerlebnisse, Geselligkeit und physiotherapeutische Übungen wirkungsvoll kombiniert. Eine wissenschaftliche Untersuchung an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg belegt, dass unsere Gesundheitswanderungen folgende Anforderungen erfüllen:
– Stärkung von Koordination, Kraft, Ausdauer und Entspannung
– Minderung von Risikofaktoren
– Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens.
Auch wurde bewiesen, dass positive Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System, auf den Stoffwechsel, auf den Bewegungsapparat, auf das Immunsystem und auf die Psyche zu verzeichnen sind.
Allerdings werden diese Effekte nachhaltig nur erzielt, wenn die Gesundheitswanderungen kursmäßig – 8 bis 10 Wanderungen pro Kurs – durchgeführt werden. Die Wanderungen dauern ca. 2 Stunden. Dabei wird auf einer Strecke von ca. 3 – 5 km abwechselnd gewandert und bei Stopps zwischendurch mit speziellen Übungen z. B. die Muskulatur gekräftigt und gedehnt und auch die Koordination geschult.
Für dieses neuartige Angebot haben wir anlässlich des 125-jährigen Jubiläums eine größere Anzahl Gesundheitswanderführerinnen und Gesundheitswanderführer ausbilden lassen. In den nächsten beiden Monaten werden über unser Vereinsgebiet verteilt dreiteilige Schnupperkurse angeboten. Diese Schnupperkurse sind kostenlos. Teilnehmen können sowohl Mitglieder als auch Nichtmitglieder.
Diese Woche fanden hier in Plochingen bereits vier Gesundheits-wanderungen statt. Eine fünfte Wanderung wird parallel zu unserer Hauptversammlung angeboten. Die Termine für die nächsten Schnupperkurse können Sie dem Flyer auf ihrem Platz entnehmen.
Ich bin überzeugt, dass die Bevölkerung in Zukunft noch mehr für ihre gesundheitliche Prävention unternehmen wird. Gesundheitswandern ist ein niederschwelliges Angebot für jeden, der etwas für seine Gesundheit machen möchte. Es ist nicht so teuer, wie die Aktionen in einem Fitnessstudio und auch nicht so anstrengend.
Für die OGn bietet sich hier eine sehr gute Möglichkeit der Mitgliederwerbung, wenn sie in ihren Jahresprogrammen Gesundheitswanderungen anbieten.
Leider kann ich in der kurzen zur Verfügung stehenden Zeit nicht alle Fachbereiche unseres Wander- und Heimatvereines ansprechen. Alle sind es wert, dass über sie berichtet werden sollte. Ich bitte Sie meine Damen und Herrn, die entsprechenden Berichte in den Albvereinsblättern und in unseren kostenlosen und monatlich erscheinenden Informationsbriefen Albverein Aktuell aufmerksam zu lesen. Ich schätze sehr die Arbeit unserer Wanderwarte, Wegemeister, Naturschützer, Volkstänzer, Brauchtums- und Mundartpfleger, Betreuer der Wanderheime und Türme und aller Aktiven, die sich zum Wohle unseres Vereines und damit auch unserer Heimat einsetzen.
Gestern hat der Hauptausschuss einen neuen Gesamtvorstand für die nächsten vier Jahre gewählt. Von den bisherigen Vorstandsmitgliedern haben bis auf Annimarie Hirschbach und Dieter Stark alle wieder kandidiert und wurden wiedergewählt. Neu in den Vorstand wurden Tanja Waidmann – ehemalige stellvertretende Hauptjugendwartin – und Rolf Kesenheimer – Gauvorsitzender des Allgäu-Gaues und Vorsitzender der OG Bergatreute gewählt.
Gewählt sind als Präsident Hans-Ulrich Rauchfuß, als Vizepräsident Reinhard Wolf und Hansjörg Schönherr, als Beisitzer im Vorstand Tanja Waidmann, Rolf Kesenheimer, Rolf-Walther Schmid und Manfred Stingel. Der Vorstand wird vervollständigt durch unseren Ehrenpräsidenten Peter Stoll und durch Hauptjugendwart Michael Neudörfer.
Auch in der Hauptgeschäftsstelle haben sich personelle Veränderungen ergeben. Seit 1. April haben wir eine Hauptgeschäftsführerin. Frau Schramm hat die Nachfolge von Herrn Abler angetreten. Des Weiteren hat Frau Steinmetz am 1. April die Nachfolge von Herrn Weiss als Wegereferentin übernommen.
Zum Abschluss meines Berichtes danke ich allen, die mich bei meiner Aufgabe unterstützt haben und die sich für unseren Verein in den Ortsgruppen, in den Gauen, im Gesamtverein, im Hauptausschuss und im Vorstand eingesetzt haben. Ich sage ausdrücklich bei allen, und meine alle ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeinsam mit ihren Familienangehörigen, Partnerinnen und Partnern.
Ein weiterer besonderer Dank gilt meinen beiden Stellvertretern Reinhard Wolf und Hansjörg Schönherr.
Für die vor uns liegende Zeit bitte ich Sie alle um Ihre Unterstützung und bitte Sie, sich weiterhin zum Wohle des Schwäbischen Albvereins und damit auch zum Wohle unserer Heimat einzusetzen. Gemeinsam können wir die Zukunft meistern.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und schließe meinen Bericht mit einem herzlichen Frisch Auf.
Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß
Herzlichen Dank
Im Namen des Schwäbischen Albvereins möchte ich allen danken, die zum Gelingen des Landesfests 2013 in Plochingen beigetragen haben, im Esslinger Gau und insbesondere dem Gauvorsitzenden Ulrich Hempel, in der OG Plochingen und insbesondere dem OG-Vorsitzenden Dieter Weiss, in den Ortsgruppen, den Volkstänzern und den internationalen Gästen, dem Gesamtverein, der Stadt Plochingen und ganz besonders Bürgermeister Frank Buß, der Gastfreundschaft ihrer Bürgerinnen und Bürger, Sponsoren, Spendern und allen anderen Personen, Institutionen und Firmen, die uns unterstützt haben. Ohne diese breite Beteiligung wäre ein Fest dieser Größenordnung nicht zu bewältigen gewesen.
Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß, Präsident des Schwäbischen Albvereins
Bilderrückblick auf das Landesfest 2013
Begrüßung und Grußworte zum Festakt 125 Jahre Schwäbischer Albverein
Albvereins-Präsident Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß:
„Mit großer Dankbarkeit denken wir an die Zusammenkunft der Vertreter mehrerer Verschönerungsvereine am 13. August 1888 in Plochingen, zu der Dr. Valentin Salzmann eingeladen hatte. Gemeinsame Interessen veranlassten die zwölf Teilnehmer nach reiflicher Beratung, einen Verein zu gründen. Keiner von ihnen konnte erahnen, dass dies der Beginn eines Wander- und Heimatvereins war, der einmal über 120 000 Mitglieder haben wird und der größte Wanderverein in Europa sein wird.“
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
mit diesem Zitat aus unserem Jubiläumsbuch begrüße ich Sie sehr herzlich zum Festakt aus Anlass des 125-jährigen Jubiläums des Schwäbischen Albvereins.
Mit großer Freude begrüße ich namentlich an erster Stelle Herrn Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Begleitung seiner lieben Frau. Es ist für uns eine besondere Ehre, dass Sie als Ehrengäste an unserem Festakt teilnehmen.
Des Weiteren begrüße ich namentlich folgende Ehrengäste
Herrn Wolfgang Drexler, Vizepräsident des Landtags Baden-Württemberg und Präsident des Schwäbischen Turnerbundes,
Herrn Fraktionsvorsitzenden Peter Hauk,
Herrn Thomas Dietz, stellvertr. Vorsitzender des Landesnaturschutzverbands,
Herrn Reinhold Frank, Vorsitzender des Sing- und Spielkreises,
Herrn Gerhard Obergfell, stellvertr. Vorsitzender des Schwäbischen Heimatbundes,
Herrn Präsident Oberacker vom Landesfischereiverband,
Herrn Vorsitzender Roland Stierle vom Landesverband des Deutschen Alpenvereins,
Herrn Armand Ducornet, Vizepräsident der Europäischen Wandervereinigung
Herrn Werner Mohr, 1. Vizepräsident des Deutschen Wanderverbands,
Herrn Ehrenpräsident Staatsminister a. D. Karl Schneider vom Deutschen Wanderverband,
Herrn Präsident Eugen Dieterle vom Schwarzwaldverein,
Herrn Vorsitzender Günter Buck und Herrn Ehrenvorsitzender Herbert Reinelt vom Mährisch-Schlesischen-Sudetengebirgsverein,
unseren Ehrenpräsident Herrn Forstpräsident a. D. Peter Stoll,
Ich begrüße eine große Anzahl Landräte, Oberbürgermeister, Bürgermeister, Vertreter der Behörden und staatlichen Verwaltungen, Freunde, Förderer und Sponsoren.
Ich begrüße unsere Ehrenmitglieder, die Mitglieder des Hauptausschusses, unsere ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Künstlerinnen und Künstler der Volkstanzmusik Frommern, die unseren Festakt musikalisch umrahmen.
Zum Schluss begrüße ich Herrn Prof. Dr. Werner Metzger, der unsere Feier durch einen Vortrag bereichern wird.
Leider kann ich Sie nicht alle namentlich begrüßen, der Zeitrahmen dieses Festaktes würde dramatisch verlängert werden müssen.
Sie alle sind als liebe Geburtstagsgäste eingeladen. Gemeinsam wollen wir das 125-jährige Jubiläum des Schwäbischen Albvereins feiern.
Über die vergangenen Jahre seit der Gründung in Plochingen bis zum heutigen Tag informiert ausführlich und anschaulich unser Jubiläumsbuch. Es beschreibt, wie der Verein sich entwickelt hat. Es schildert das Erreichte, was unser Schwäbischer Albverein heute ist, die vielen Aufgaben, mit denen sich unser Wander-, Naturschutz- und Heimatverein beschäftigt. Das Buch gibt auch einen Ausblick auf die vielen Aufgaben, die noch vor uns liegen. Wir bleiben nicht im Heute stehen, sondern wir gehen aktiv in die Zukunft.
Der Schwäbische Albverein ist heute ein moderner Verein, der stolz auf seine Tradition zurück blicken kann. Allen, die hierzu mit beigetragen haben, danke ich an dieser Stelle sehr herzlich. Ich danke meinen acht Amtsvorgängern, dass sie unseren Albverein erfolgreich aufgebaut und in der langen Zeit geleitet haben. Persönlich kann ich mich bei unserem Ehrenpräsident Peter Stoll bedanken. Lieber Peter ich freue mich sehr, dass Du heute mit uns feiern kannst. Dein Name ist mit dem Schwäbischen Albverein eng verwoben. Du hast den Albverein erfolgreich weiter entwickelt und positiv geprägt. Wir sind Dir sehr zu Dank verpflichtet.
Ich habe gerade von unserem Jubiläumsbuch berichtet. Es ist rechtzeitig zum heutigen Tag fertig geworden. Ich freue mich, dass ich es heute Ihnen vorstellen und Ministerpräsident Kretschmann das erste Exemplar überreichen kann.
Grußwort von Armand Ducornet, Vizepräsident der Europäischen Wandervereinigung
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,
lieber Präsident Hans-Ulrich Rauchfuß,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde,
Chers Amis
Im Namen der Präsidentin der Europäischen Wandervereinigung, Lis Nielsen, danke ich dem Präsidenten Hans-Ulrich Rauchfuß, dass er uns diese Gelegenheit angeboten hat, Ihnen ein Grußwort auszusprechen.
Für mich persönlich ist es zusätzlich eine große Ehre, hier an diesem Pult stehen zu dürfen. Ich bin im Stuttgarter Raum gar nicht fremd, da meine Familie mütterlicherseits aus der Göppinger Gegend stammt. Ich bin öfters im Ländle, natürlich oft auf der Alb, aber nicht nur. Und wie viele wissen, Mitglied der Ortsgruppe Trossingen.
Wir halten es für eine Selbstverständlichkeit, sogar eine Pflicht, dass die Europäische Wandervereinigung das Jubiläum eines der größten Wandervereine in Europa mitfeiert, zumal der Schwäbische Albverein auch ein Gründungsmitglied der Europäischen Wandervereinigung ist. Ich erinnere daran, dass die Europäische Wandervereinigung im Oktober 1969 im Nägelehaus gegründet wurde.
Der Schwäbische Albverein leistet einen wichtigen Beitrag in der Entwicklung des Wanderns, hier in Baden-Württemberg, in Deutschland, aber auch im Rahmen der Europäsischen Wandervereinigung. Wir möchten uns hier für die ständige Unterstützung seitens des Albereins in unseren Aktionen für die europäischen Wanderer bedanken. Die Europäische Wandervereinigung arbeitet zur Zeit an einer Satzungsänderung. Der Schwäbische Albverein gehört zu den Organisationen, die geholfen haben, das Bestvernünftigste daraus zu machen.
Zu den eben erwähnten Aktionen zählt insbesondere der EWV-Umweltpreis, und da möchte hier den von Reinhard WOLF, dem Vizepräsidenten des Albvereins, entscheidenden geleisteten Beitrag in der Erarbeitung des EWV-Umwelt-Preises “Eco Award” unterstreichen. Er hat uns seine hohen Kompetenzen zur Verfügung gestellt. Dafür hat er unseren herzlichen Dank verdient. Das wollte ich öffentlich bekannt machen.
Ganz natürlich, war der Schwäbische Albverein 2011 der erste Preisträger dieses europäischen Preises, dank der langjährigen und beispielhaften Arbeit am Schopflocher Moor.
Der Albverein kennt ähnliche Probleme wie andere Wandervereine bzw. Verbände z. B. mit der Suche nach neuen ehrenamtlichen Kräften. Ich weiß, dass der Präsident Hans-Ulrich Rauchfuß sich damit auseinandersetzen muss. Ich wünsche ihm, Euch, diesbezüglich viel Erfolg, denn wir brauchen den Albverein, als einen wichtigen, ich möchte behaupten unersetzbaren Akteur im Dienste der Freizeit, des Tourismus. Hiermit meine ich den Tourismus als Wirtschaftsfaktor, was die Studie des Deutschen Wanderverbands deutlich dokumentiert.
Ich könnte noch weitere Schwerpunkte nennen, wie z. B. Familien- und Jugendarbeit. Sie alle aufzulisten, wäre zu lang.
In diesem Sinne wünsche ich Euch allen im Namen der Präsidentin, der gesamten Europäischen Wandervereinigung, viele weitere und erfolgreiche Jahrzehnte.
Grußwort von Werner Mohr, 1. Vizepräsident des Deutschen Wanderverbands
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,
sehr geehrter Herr Präsident Rauchfuß, lieber Uli,
verehrte Ehrengäste,
sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Wanderfreundinnen, liebe Wanderfreunde,
da der Präsident des Schwäbischen Albvereins – also Ihr Präsident – gleichzeitig Präsident des Deutschen Wanderverbands ist, darf ich Ihnen als Vizepräsident des Deutschen Wanderverbands die besten Grüße und herzliche Glückwünsche zum 125-jährigen Jubiläum des Schwäbischen Albvereins überbringen.
Verbunden mit den Grüßen ist vor allem der Dank des Deutschen Wanderverbands an Sie für das große Engagement im Dienste des Wanderns, der Wegearbeit, des Natur- und Umweltschutzes, der Kulturarbeit , der Heimat- und Brauchtumspflege, sowie der Jugend- und Familienarbeit.
Der Schwäbische Albverein war und ist die Stütze des Deutschen Wanderverbands. So darf ich erinnern: Georg Fahrbach – Ihr Präsident und langjähriger Präsident des Deutschen Wanderverbands, Prof. Dr. Helmut Schönamsgruber, Peter Stoll und Ihr jetziger Präsident Ulrich Rauchfuß. Aber auch alle anderen Wanderfreundinnen und Wanderfreunde des Schwäbischen Albvereins, die in vielen verantwortlichen Funktionen beim Deutschen Wanderverband mitgearbeitet haben.Dafür Ihnen allen ein herzliches Dankeschön.
Wandern ist und bleibt die natürlichste Fortbewegung des Menschen und trainiert den ganzen Körper. Gleichzeitig wirkt das Wandern aber auch sehr positiv auf Geist und Seele des Menschen – Wandern ist also erleben und genießen.Richtig verstandenes Wandern befreit von Stress, stabilisiert die Gesundheit und stärkt die Widerstandskraft des Körpers.Wandern ist eine Ganzjahresverführung: Überall möglich, beliebig variierbar.
Wandern ist praktische Gesundheitsvorsorge – Fitness für Jung und Alt.
So hat der Deutsche Wanderverband gerade mit Unterstützung des Schwäbischen Albvereins das Gesundheitswandern, Familien- und Jugendwandern, das Schulwandern, die Wanderführerausbildung u.v. mehr „auf den Weg“ gebracht und hier deutliche Akzente gesetzt.
Vergessen wir nicht den Natur- und Umweltschutz mit all seinen Aufgaben wie Klimawandel, Energiewende und alternative Energie aber auch Biotopschutz und Pflege von Wacholderheiden.
Die Kulturarbeit mit Heimat- und Brauchtumspflege.
Wandervereine sorgen für Nachhaltigkeit. Denken Sie nur an unsere über 100 Jahre lange Wegemarkierung. „Wir setzen Zeichen“!
Unsere 58 Mitgliedsvereine im Deutschen Wanderverband – und da ist der Schwäbische Albverein der größte – leisten im Jahr rund 7 Mill. ehrenamtliche Arbeitsstunden im ganzen Spektrum der Vereinsaktivitäten (bei 12.- € Ansatz sind dies 84 Mill €, den wir für unsere Gesellschaft erbringen. Eine tolle Leistung!
„Alles fließt, und nichts bleibt gleich“
Was griechische Philosophen schon vor Jahrtausenden formulierten, gilt heute mehr denn je: Daher dürfen wir weiterhin den Blick in die Zukunft nicht verlieren. Es muss uns gewiss sein, dass das Wandern sich wandeln wird, wie die Menschen sich wandeln werden:
- GPS, Armbandcomputer mit Satelittennavigation lassen die Orientierung zum Kinderspiel werden
- Markierungen werden zu uns über Miniaturempfänger sprechen
- Pulsuhrencomputer werden uns das Laufen lehren, die Herzfrequenz messen, diesen uns anzeigen und unsere Schritte mäßigen oder beschleunigen helfen.
Doch —- es werden immer noch unsere eigenen Füße sein, unsere Ohren, unsere Augen, unsere Nase, mit denen wir wandern, hören, schauen oder riechen. Wir werden nicht schneller wandern, wie das Tempo, das uns Wanderern angeboren ist. Und das ist gut so !
Für die Zukunft rufe ich Ihnen und dem Schwäbischen Albverein zu: Sorgen Sie dafür, dass Sie mit dem Schwung von heute die Aufgaben von morgen angehen.
Im Namen des Deutschen Wanderverbands wünsche ich dem Schwäbischen Albverein weiterhin eine glückliche Hand, viel Erfolg und vor allem erlebnisreiche Wanderungen.
Der offene Blick nach vorn wird dem Schwäbischen Albverein nicht nur die eigene Zukunft sichern, sondern dem Gemeinwohl in der ganzen Region dienen.
Grußwort von Eugen Dieterle, Präsident des Schwarzwaldvereins
Herr Präsident Rauchfuß, lieber Uli,
liebe Wanderfreunde und Gäste des Schwäbischen Albvereins.
Der Schwarzwaldverein gratuliert zum 125-jährigen Bestehen des Schwäbischen Albvereins.
Ich nehme das zum Anlass, um mich bei den Wanderfreunden des Albvereins für das gute Miteinander zu bedanken.
Was uns vereint, ist die gemeinsame Sorge um den Erhalt unserer Heimat, die Sorge um die Kulturlandschaften in Baden Württemberg.
Für gute , nachhaltige Beziehungen braucht es aber nicht nur gemeinsame Ziele, es sind vor allem die persönlichen Kontakte, die Freundschaften, welche im Laufe der Jahre entstanden sind, dafür möchte ich ganz persönlich besonders danken. Ich habe die Treffen der Präsidien von Schönnnamsgruber über Peter Stoll bis zu Dr. Rauchfuß immer genossen, und auch bei den Fachwarten gibt es einen regen Austausch und viele Begegnungen.
Äußeres, sichtbares Zeichen der Zusammenarbeit ist die vor 12 Jahren gemeinsam gegründete Heimat- und Wanderakademie Baden-Württemberg. Diese Bildungseinrichtung für die Heimat und das Wanderwesen ist ein Segen für beide Vereine. Viel Arbeit und Idealismus wird hier investiert, mein besonderer Dank gilt den Wanderfreunden Peter Stoll, Alfred Heffner, Willi Rößler, Bernd Magenau und Hans Martin Stübler als die Leiter der Akademie.
So wichtig wie für die Leitungsebenen der Vereine die Begegnungen und der Austausch sind, so wichtig sind die Begegnungen auch unter den ganz normalen Wanderern und Mitgliedern.
Sie wissen ja alle, man kann nur Schützen und Bewahren, was man kennt, darauf bezieht sich auch mein Jubiläumsgeschenk an die Mitglieder des Schwäbischen Albvereins.
Der Schwarzwaldverein schenkt den Mitgliedern des Schwäbischen Albvereins für die nächsten 25 Jahre die kostenlose Benutzung der Wanderwege des Schwarzwaldvereins, das sind 23.000 km.
Sie sind herzlich willkommen im Schwarzwald, erleben sie ihn mit der Nähe zu Frankreich und der Schweiz, seinen Menschen und kulinarischen Genüssen.
Wenn Sie als Ortsgruppe kommen wollen, rufen Sie eine Ortsgruppe in der Nähe Ihres Wanderziels an, wir helfen gerne bei der Planung und Führung.
Herr Präsident, darf ich Ihnen die Urkunde überreichen, der Text lautet:
Der Schwarzwaldverein – Hauptverein –
Gratuliert dem Schwäbischen Albverein zum 125 jährigen Bestehen
Verbunden mit dem Dank für den Aufbau und die Pflege freundschaftlicher Beziehungen zwischen den beiden Wanderverbänden.
Anlässlich dieses Jubiläums räumt der Schwarzwaldverein den jetzigen und künftigen Mitgliedern des Schwäbischen Albvereins das Recht ein, auf den Wegen des Schwarzwaldvereins zu wandern und freut sich auf ein weiterhin kameradschaftliches Miteinander.
Stuttgart 4. Mai 2013 Eugen Dieterle, Präsident
Festrede zum Festakt 125 Jahre Schwäbischer Albverein
Prof. Dr. Werner Mezger hielt am 4. Mai 2013 die Festrede »125 Jahre Schwäbischer Albverein«. Sie wurde von ihm zur Verfügung gestellt, die Redeform wurde beibehalten.
Sie können die Rede hier als pdf herunterladen.
Sehr verehrter Herr Ministerpräsident,
sehr verehrter Herr Präsident Dr. Rauchfuß,
sehr verehrte Vertreterinnen und Vertreter des öffentlichen Lebens,
sehr verehrte Ehrengäste,
meine sehr verehrten Damen und Herren.
Die wirklich wichtigen Reden des heutigen Tages sind bereits gehalten worden. Mit Spannung erwartet man die Ansprachen der Politiker. Ihr Kommen – das Ihrige, Herr Ministerpräsident, ganz besonders – ist eine hohe Ehre. Ihr Wort hat Gewicht. Bei Ihnen hört man genau zu, was Sie sagen, wie Sie es sagen, was Sie nicht sagen und was Sie eventuell zwischen den Zeilen sagen. Und über allem schwebt natürlich immer die Frage: Hat er etwas mitgebracht? Ein Versprechen, eine Vision oder am besten gleich einen Scheck? Nicht minder gewichtig die Ausführungen des Vereinspräsidenten wie auch die Grußworte all jener Akteure, die Verantwortung tragen. Sie stehen in der Praxis. Sie haben vieles bewegt und werden noch vieles bewegen. Ihnen ist die Aufmerksamkeit sicher.
Und dann kommt, wenn die Spannung sich längst gelegt hat, eben auch noch der Festredner. Er gehört irgendwie unvermeidlich zum Ritual eines Jubiläums. Er hat nichts zu verteilen, keine Möglichkeit des aktiven Eingreifens – ihm bleibt allein das Wort. Mehr nicht. Der routinierte Festredner weiß, dass er offiziell unverzichtbar, inoffiziell aber absolut entbehrlich ist, dass er an den Anfang seiner Ausführungen eine breite Würdigung zu stellen hat, danach ein möglichst imposantes Zahlenwerk aus Daten, Fakten und Stationen entwickeln muss und dass es ihm am Ende der Laudatio obliegt, in eine wortreiche Gratulation einzumünden, verbunden mit den besten Wünschen für die Zukunft. Dies sind die rhetorischen Standards, die erwartet werden und als schicklich gelten, zumindest wenn man dem gängigen Schema folgt.
1.
Aber genau das möchte ich nicht tun. Statt der üblichen Höflichkeiten und Verherrlichungen will ich lieber ein paar Denkanstöße geben, will mit dem heutigen Jubilar, dem Schwäbischen Albverein, den Fokus weniger auf die Vergangenheit als auf die Gegenwart und die Zukunft richten. Aber ein Ausblick geht natürlich nie ganz ohne Rückblick. Und diesen eröffne ich mit der Feststellung: Die größte Leistung des Schwäbischen Albvereins war die Erfindung der Schwäbischen Alb.
Nein, das ist kein Hörfehler. Die Schwäbische Alb musste erst erfunden werden. Sie war und ist nämlich nicht einfach eine Realität, sondern sie beruht auf Bildern, die wir uns von ihr machen. Und solche Bilder in den Köpfen wiederum sind das Ergebnis von jeweils zeittypischen Sichtweisen.
In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts zum Beispiel war die Vorstellung von der Alb noch gar nicht positiv. So heißt es etwa in Johann-Heinrich Zedlers Universallexikon von 1732 ff. (Bd. 1, Sp. 920): „Alb […] ist ein rauher und Bergigter Strich Landes in Schwaben, wovon das meiste dem Hertzogthum Würtenberg gehöret, und sich von Reutlingen, Urach und Kirchheim gegen die Donau hin erstrecket […] hat Mangel an Wasser.“ Keinen guten Faden lässt das Lexikon also an der Alb, und ihre Ausdehnung über runde 200 Kilometer von Tuttlingen bis Nördlingen wird auch noch nicht gesehen, vom Blick für Naturschönheiten ganz zu schweigen. Das kommt erst später.
Ab 1775 etwa. Da beginnt sich ganz allmählich die Natur- und Landschaftswahrnehmung zu ändern. Jean Jacques Rousseau mit seiner Maxime „retour à la nature“ spielt hier ebenso eine Rolle wie Goethes in seinen Schweizer Reisetagebüchern entwickelte Sicht der Alpen, die nun plötzlich nicht mehr die „montes horribiles“, die schrecklichen Berge sind, sondern ein tiefes Erlebnis, ein Sinnbild für die Allmacht der Schöpfung.
Bald darauf werden in der Malerei Landschaftsbilder ein Thema: Schneeberge wie der Watzmann, der Staubbach-Wasserfall im Berner Oberland, die burgengekrönten Steilfelsen des Mittelrheintals. Das eröffnet auch eine neue Perspektive auf die Alb. Plötzlich ist sie nicht mehr nur der Ungunstraum mit der rauen Hochfläche ohne Wasser, sondern ihre Schönheiten werden entdeckt. Insbesondere der Albtrauf in der Gegend von Reutlingen gerät ins Blickfeld und erlebt einen regelrechten Popularitätsschub.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wächst auf der Reutlinger Alb das Interesse an den Höhlen. Die Nebelhöhle, wohl schon seit dem 15. Jahrhunderts bekannt, wird 1803 von Kurfürst Friedrich I. besucht und mit 1000 Kerzen festlich illuminiert. An zusätzlicher Faszination gewinnt sie nach 1826 durch Wilhelm Hauffs Roman „Lichtenstein“, der schildert, wie sich einst Herzog Ulrich im „Nebelloch“ versteckt haben soll. 1834 dann die Entdeckung der Bärenhöhle – die berühmte Geschichte mit der in die Tiefe gefallenen Tabaksdose des Erpfinger Lehrers Fauth. Schließlich der Lichtenstein-Mythos. Beflügelt durch den Hauff’schen Roman wird das bescheidene Forsthaus, das von der einstigen Burg auf dem Felsen über Honau noch übrig war, 1836 abgerissen, um dem 1840 bis1842 nach Plänen von Carl-Alexander von Heideloff errichteten, historistischen Märchenschlösschen Platz zu machen – inzwischen Ikone der Alblandschaft: Romantik pur.
Aber die Romantik war alles andere als verträumt. Sie war hochpolitisch. Nach dem Zerfall des heiligen Römischen Reiches waren ihre Vertreter, allen voran die Brüder Grimm, auf der Suche nach einer neuen nationalen Identität. Sie wirkten entscheidend mit an dem Prozess, den Historiker heute als nationbuilding bezeichnen. Vertreter des Bildungsbürgertums nahmen das Schicksal der Nation jetzt in die Hand. Sie organisierten sich, modellierten ihren eigenen Kulturbegriff und setzten auf die kreative Kraft der „Volksseele“, wie sie Johann-Gottfried Herder beschrieben hatte. Mit der Entdeckung der Denkmäler der Nationalliteratur entstanden die literarischen Vereine, mit dem Interesse am Volkslied die Gesangvereine und Liedertafeln und endlich, ab den 1860er-Jahren, die so genannten Verschönerungsvereine.
Diese waren eine Antwort auf die zunehmende Industrialisierung, die immer mehr bäuerliche Idyllen und lauschige Orte verschwinden ließ. So ist es kein Zufall, dass gerade zwischen Reutlingen und Esslingen die Verschönerungsvereine besonders aktiv waren. Esslingen, wozu auch Plochingen gehörte, erlebte im 19. Jahrhundert, einsetzend bereits um 1830, den stärksten Industrialisierungsschub in ganz Württemberg. Und genau da, in den Transformationsprozessen der Industrialisierung, beginnt auch die Geschichte des Arztes Dr. Valentin Salzmann, der zum Vater des Albvereins werden sollte. 1867 hatte er den Verschönerungsverein Esslingen gegründet. Gut zwei Jahrzehnte später, am 13. August 1888, arrangierte er ein Treffen von Gleichgesinnten in Plochingen, dessen Ziel es eigentlich war, die Arbeit der Verschönerungsvereine zu optimieren.
Bei dieser Zusammenkunft aber ging Salzmann noch einen Schritt weiter. In überlokalen Kategorien denkend und mit Blick auf den bereits bestehenden Schwarzwaldverein stellte er seine Idee eines Albvereins vor. Das versammelte Gremium, zwölf Männer aus verschiedenen Verschönerungsvereinen, war davon angetan. Am 12. November 1888 fand dann in noch größerer Runde, nämlich in Anwesenheit der Vertreter von 18 Verschönerungsvereinen, wiederum in Plochingen die Gründungsversammlung des Schwäbischen Albvereins statt. Die Vision war, den gesamten Albtrauf vom Ipf bis zum Heuberg in den Blick zu nehmen und damit die Aufgaben der örtlichen Verschönerungsvereine geographisch wie auch inhaltlich zu erweitern. Einen ganz zentralen Stellenwert hatte dabei der Gedanke der Erschließung des Gebiets durch Wandern.
Und eben das war der Beginn der „Erfindung“ der Schwäbischen Alb: die Bewusstmachung eines einzigartigen Landschafts- und Kulturraums. Eines Gebiets, das nun, der geologischen Formation folgend, weit über den einstigen Vorzeigekern der Reutlinger Alb hinausgriff. Vor allem kam jetzt auch die Hochfläche in den Blick: Ein wirtschaftlicher Ungunstraum mit ständiger Wasserknappheit, kargen Lebensbedingungen und großer Armut wurde plötzlich zumindest in der Außenperspektive liebevoll als etwas Besonderes entdeckt. Und dazu gehörte von Anfang an die ganzheitliche Sicht – nicht nur die Perspektive auf die landschaftlichen Reize, sondern auch auf die Lebensentwürfe von Menschen, welche die Not erfinderisch gemacht hatte. Die Bewunderung für kluge Köpfe, weit über Philipp Matthäus Hahn hinaus. Und natürlich die Sympathie für Originale mit Eigenheiten, Kanten und markanter Mundart. Es war keineswegs nur spröde Distanzierung, sondern eher augenzwinkernde Solidarität, wenn man drunten im Tal diejenigen von der Hochfläche imitatorisch mit rollendem Zungen-„R“ als eine der drei größten Landplagen apostrophierte: „Lepra, Cholera, vu dr Alb ra“.
Dabei gibt es den Älbler als generalisierbaren Typus eigentlich gar nicht. Vielmehr bilden die Albbewohner, die dort seit Generationen leben, unzählige kleine Solidar- und Schicksalsgemeinschaften, von denen jede ein bisschen anders ist. Das Spektrum menschlicher Möglichkeiten reicht von den urbanen Kosmopoliten im Umland von Ulm bis hin etwa zu den verschmitzt herben Charakteren im Killertal zwischen Schlatt und Burladingen. Als Hausierhändler mit selbst gemachten Bürsten, Körben und Peitschen im Angebot, hat sich einst ein Großteil der Killertäler durchs Leben geschlagen, weshalb viele dort noch heute eine Geheimsprache, eine Art Rotwelsch beherrschen, das sogenannte „Pleißne“. Der Fremde versteht nichts davon, wenn sich zwei ältere Killertäler in dieser Sonderform des Schwäbischen verständigen, und er merkt erst recht nicht, dass es um ihn selber geht, wenn die beiden zueinander sagen: „S’ischt a Kachel z’viel im Ofe, pleißnet, dass des Pinkle koan Watze a’stubt.“ Heute handelt im Killertal niemand mehr mit Peitschen, nur noch ein Museum erinnert an die Zeiten der Wanderhändler. Nicht wenige von ihnen sind inzwischen erfolgreiche mittelständische Unternehmer mit eigenem Fabrikle. Die besonders Armen erwiesen sich oft als die Pfiffigsten. Auch das gehört untrennbar zum Bild der Schwäbischen Alb.
Der Albverein ist von Anfang an all dem im umfassenden Sinne interessiert. Natur- und Heimatkundler, die ihm angehören, stellen ihr Wissen der Gemeinschaft zur Verfügung und veröffentlichen Texte. Schon kurz nach der Gründung des Vereins erscheint erstmals sein Periodikum, das bis heute existiert: die fast schon legendären „Blätter des Schwäbischen Albvereins“. Sie liefern die Erklärungen zur Landschaft und die Erzählungen zu ihren Bewohnern, modern ausgedrückt: Sie produzieren die Narrative. Der Verein wächst rasant. Um 1900 beträgt die Mitgliederzahl schon fast 24.000, vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs sind es rund 40.000 in 650 Ortsgruppen. Eine ungeheure Erfolgsgeschichte.
Der Verein stellt vieles auf die Beine, und er ermuntert vor allem zum Gebrauch der Beine, indem er ein einzigartiges Wanderwegenetz entwickelt. Er erschließt neue Erfahrungsräume, vermittelt Einsichten und schafft Aussichten – letzteres durch den Bau von Türmen. 29 sind es heute. Der erste Aussichtsturm des Vereins entsteht 1896. Der zweite, der Lembergturm auf dem mit 1015 Metern höchsten Berg der schwäbischen Alb, im Jahr 1899. Er hat mich schon als Kind fasziniert: eine Eisenkonstruktion, elegant geschwungen und sich nach oben verjüngend. Das kam nicht von ungefähr: Zehn Jahre vorher war in Paris der Eiffelturm entstanden. Auf der Alb steht die Volksausgabe davon, unverkennbar.
Inzwischen hat der Verein seinen geographischen Aktionsbereich weit über den Kernraum der Schwäbischen Alb hinaus ausgedehnt: nach Norden und Nordosten bis in den Taubergrund und südlich über Oberschwaben bis an den Bodensee. Das ist ein riesiges Gebiet. Die drei großen inhaltlichen Säulen sind Wandern, Heimat und Natur, ergänzt durch viele weitere Facetten, natürlich auch Kultur. Und besonders wichtig dabei ist der Schutzgedanke – im Landschafts- und Naturschutz ebenso wie im Denkmalschutz. In die Würdigung der großen Namen will ich hier gar nicht eintreten: Nägele, Fahrbach, Schönamsgruber, Stoll, Rauchfuß und viele mehr. Deutlich machen aber möchte ich in meiner Geschichte der Freundlichkeiten doch noch, dass der Albverein, wenn Natur und Umwelt bedroht sind, seine Harmonielinie durchaus auch einmal verlassen und streiten kann. Dass etwa der Schönbuch und der Schurwald heute noch als ungestörte Räume erhalten sind und nicht irrsinnigen Flugplatzplänen geopfert wurden, ist wesentlich auch der massiven Intervention des Albvereins zu verdanken. 125 erfolgreiche Jahre also, eine rundum imponierende Geschichte und eine stolze Bilanz. Mit rund 110.000 Mitgliedern und 571 Ortsvereinen ist der Schwäbische Albverein heute der größte Wanderverein Europas.
2.
Von der Vergangenheit wenden wir den Blick nun in die Zukunft. Wie soll es weiter gehen? Die Welt von heute ist nicht mehr die Welt von gestern. Und wie die Welt von morgen aussehen wird, zeichnet sich erst langsam ab. Die großen Schlagworte unserer Gegenwart sind Globalisierung, Mobilität, Migration, Transformationsprozesse der fortgeschrittenen Moderne.
Um den heutigen Standort und die künftige Rolle des Albvereins ein wenig einschätzen zu können, schiebe ich ein paar theoretische Überlegungen ein, die Sie mir bitte nachsehen. In der europäischen Ethnologie, die ich an der Universität Freiburg vertrete, verwenden wir gerne das Modell von den drei großen Kulturdimensionen. Die erste dieser drei Kulturdimensionen ist die Zeit, die zweite der Raum, die dritte die Gesellschaft. Jedes Kulturphänomen wird bestimmt durch diese drei Dimensionen, durch Zeit, Raum und Gesellschaft. Wozu nun diese trockene Theorie? Weil man mit Hilfe der drei Kulturdimensionen manches klarer sehen und auch zeigen kann, welche Umbrüche wir gerade erleben.
Beginnen wir mit der Dimension Zeit: Zeit ist eine physikalisch messbare Größe, und die Zeit auf unserer Erde verläuft seit Jahrmillionen gleich. Nur – gefühlsmäßig nehmen wir heute Zeit als etwas wahr, was unsere Vorfahren noch hatten, was uns aber chronisch fehlt. „Tut mir leid, ich habe keine Zeit“, „mir läuft die Zeit davon“, „Zeit ist Geld“, „der Zeitdruck macht mich krank“, „immer diese Zeitpeitsche“ – das sind Formulierungen, die wir tagtäglich hören oder selber gebrauchen. Dabei ist eines besonders grotesk: Noch nie stand dem Menschen objektiv so viel Zeit zur Verfügung wie heute, denn noch nie war die Lebenserwartung so hoch wie in unseren Tagen. Und noch nie glaubten die Menschen subjektiv so wenig Zeit zu haben wie heute. Dieses Unverhältnis zur Zeit, die wir übrigens inzwischen mit unglaublicher Exaktheit messen können, ist typisch für alle westlichen Industriegesellschaften.
Wie grotesk die Situation ist, in der wir uns da befinden, entlarvt sehr schön eine Geschichte aus dem europäisch-afrikanischen Kulturvergleich – se non è vero è ben trovato: Ein Europäer führt einem Afrikaner voller Stolz seine neue Funkuhr vor, ein Hightech-Produkt, das an Präzision nicht mehr zu übertreffen ist. Der Afrikaner schaut sich das Wunder der Technik in Ruhe an und resümiert dann lächelnd: „Ja, so ungleich ist die Welt: Ihr habt die Uhr, aber wir haben die Zeit“.
Typisch für die Kultur der westlichen Industrienationen ist, dass unsere Vorfahren die Zeit noch zyklisch erfahren haben, als ein Kreisen um sich und Münden in sich selbst, während sie für uns ein linearer Prozess ist, der unumkehrbar in eine Richtung verläuft und irgendwo an die Grenze unseres eigenen Todes stößt. Und vor allem – für uns hat die Zeit völlig ihre Rhythmen verloren. Wir machen die Nacht zum Tage, wir vermischen Arbeit und Freizeit, wir tun mehrere Dinge gleichzeitig und machen alles immer schneller. Oft steht am Ende der Herzinfarkt, der genau besehen nichts anderes ist als ein Zeitinfarkt. Gesellschaften ohne unseren Zeitdruck kennen dieses Phänomen nicht.
Ich komme zur zweiten unserer drei Kulturdimensionen: zum Raum. Da gibt es zunächst eine ganz einfache Feststellung. Die Welt ist kleiner geworden. Analog zur Zeit, die scheinbar immer schneller läuft, schrumpft die Welt. Mit hohen Geschwindigkeiten, wie sie sich unsere Vorfahren nicht einmal hätten träumen lassen, legen wir große Distanzen zurück, eilen von Stadt zu Stadt, von Land zu Land, von Kontinent zu Kontinent und verlieren darüber völlig das natürliche Gefühl für Räume und Weiten. Und noch etwas: Die Art und Weise, wie wir uns heute im Raum orientieren, wie wir uns Räume aneignen, hat sich revolutionär verändert. Im Zeitalter von GPS und Navigationsgeräten wählen wir unsere Wege nicht mehr selbst, sondern lassen uns führen. Statt selber zu suchen und zu finden, lassen wir uns bequem gängeln und folgen blindlings wie die Lemminge elektronischen Systemen. Eng verwandt mit GPS, mit dem satellitengestützten Global Positioning System, sind die virtuellen Globen. Mit Errungenschaften wie Google Maps, Google Earth und Virtual Earth können wir uns jeden Ort, jede Straße, jeden Hinterhof dieser Welt per Satellitenfoto in Sekundenschnelle auf den eigenen Bildschirm holen. Das ist faszinierend und ernüchternd zugleich. Die Schrumpfung der Welt hat den Globus zu einer Art Dorf werden lassen. Ereignisse, die viele tausend Kilometer entfernt geschehen, verfolgen wir in unserer Wohnstube; und sie ängstigen uns, weil wir wissen, dass sie unmittelbare Auswirkungen auf jeden von uns haben.
Je kleiner die Welt wird, durch Verkehrsmittel, durch transkontinental agierende Konzerne, durch die Massenmedien, durchs Internet – desto mehr Schaden nimmt die kulturelle Vielfalt. Hamburger und Cheeseburger gibt es inzwischen überall, während immer mehr regionale und lokale Eigenheiten verloren gehen und den Prozess beschleunigen, den wir in der Forschung als „McDonaldisierung der Welt“ bezeichnen.
Bleibt noch die letzte unserer drei Dimensionen: Gesellschaft. Sie ist heute mobiler, offener, vielfältiger, vor allem fremder geworden als früher. Längst gilt auch schon für die kleinsten Dörfer, dass nicht mehr jeder jeden kennt. Die Mobilität würfelt uns durcheinander, und der Zustrom von Migranten zwingt uns zur Begegnung mit anderen Kulturen, ob wir wollen oder nicht. Auch das verunsichert uns, und viel wäre noch darüber zu berichten.
Hat in einer so veränderten Welt, muss man fragen, der Schwäbische Albverein überhaupt noch Zukunft, ist er nicht hoffnungslos überholt, früher oder später zum Untergang verurteilt? Ich sage: Nein. Ich sage sogar: Ganz im Gegenteil, denn gerade die rasanten Veränderungen der Zeit erfordern Antworten. Und eine davon ist – hiervon bin ich überzeugt – der Schwäbische Albverein.
Machen wir’s wieder systematisch und beginnen wir mit der Kulturdimension Zeit: Angesichts der Auflösung aller Ordnungen, des Verlusts aller Rhythmen haben die Menschen heute einen stillen Wunsch: die Wiedergewinnung eines Restes von Zyklizität. Das erklärt zum Beispiel die heutige Freude an Festen und Bräuchen, den Boom traditionellen Feierns. Das „Alle Jahre wieder“ des Weihnachtslieds ist nämlich mehr als nur eine Platitüde, es ist ein Wert an sich. – Der Albverein fördert dieses Bewusstsein auf seine Weise, zum Beispiel in der Kulturarbeit durch die Erinnerung an alte Jahreslaufbräuche, und er öffnet den Menschen durch seine Hilfe bei der Naturwahrnehmung die Augen für den Wechsel der Jahreszeiten und Vegetationszyklen. Er zeigt uns, was viele heute gar nicht mehr sehen – eine hoch verdienstvolle Leistung.
Nehmen wir die zweite Dimension: den Raum. Auch in diesem Kontext fällt dem Schwäbischen Albverein eine wichtige Rolle zu. Er steht inmitten von Globalisierung und Gleichmacherei noch immer für lokale Besonderheit. Er ist so etwas wie eine Bastion gegen die kulturelle Einebnung der Welt. Als gewichtige Bildungsagentur, so darf man ihn wohl nennen, macht er den Menschen die Spezifik und Einzigartigkeit der Landschaft bewusst, in der sie leben. Er stiftet Identität, generiert Heimat und sorgt für Verortung. Und er verkörpert inzwischen, wie wir wissen, eben nicht nur die Schwäbische Alb, sondern viel mehr – zusammen mit dem Schwarzwaldverein sogar den ganzen deutschen Südwesten in seinem Formenreichtum, seiner Unverwechselbarkeit und Vielfalt.
Und nehmen wir zum Schluss die Dimension Gesellschaft: Die Auflösung der gemeinsamen sozialen Horizonte zwingt zur Suche nach neuen Formen guten Zusammenlebens und nach Wegen des sich Kennenlernens. Vereine haben hier besondere Möglichkeiten, Fremde zu integrieren – allen voran die Jugendabteilungen der Sportvereine. Aber auch der Albverein fühlt sich hier in der Pflicht. Die Einbeziehung von Fremden, vor allem von Kindern aus Migrantenfamilien, ist für ihn längst ein Thema – nachzulesen in der Festschrift, wenn auch die Umsetzung manchmal schwierig ist. Und das ganz große Pfund, mit dem der Albverein wuchern kann, ist nicht zuletzt das hohe Maß an Bildungsgerechtigkeit, das er verkörpert. Seine Angebote richten sich buchstäblich an alle. Jeder kann mitmachen: Einheimische, Zugezogene, ohne soziale Barrieren, Schichten überquerend. Das zeichnet auch seine vorbildliche Jugendarbeit aus. Man könnte sogar, wenn die Jugendgruppen erst einmal bunt genug sind, die Begegnung des Eigenen mit dem Fremden selbst zum Thema machen. Der interkulturelle Blick auf kulturelles Erbe lohnt immer und bereichert. Der Albverein ist dafür gerüstet. – Soweit unsere kleine Systematik zu den drei Kulturdimensionen Zeit, Raum und Gesellschaft.
3.
Zum Schluss noch einige ganz praktische Probleme der Gegenwart, die in der Arbeit und den Zielsetzungen des Schwäbischen Albvereins zwangläufig auch Herausforderungen für die Zukunft sind: Eine der zentralen Veränderungen gegenüber früher, die es dem Albverein, ja die es jedem Verein schwer machen, ist die heutige Individualisierung der Gesellschaft. Dass man, wie es der Name „Verein“ eigentlich vorgibt, etwas mit „vereinten“ Kräften tut, ist nicht mehr die Regel, es ist die Ausnahme geworden. Heute triumphiert der Einzelne, nicht mehr die Gemeinschaft. Der Gemeinsinn, von dem der Schwäbische Albverein immer profitiert hat, wird vom Eigensinn verdrängt. Und diese Egoismen führen zur Pluralisierung der Sichtweisen. Sie lassen gemeinsame Bilder, auch den Konsens über Landschaften zerbrechen. Es kommt es zur Fragmentierung von vormals geschlossenen Landschaftsbildern. Die Alb bleibt davon nicht verschont. Ihr einstiges Gesamtbild zerbröckelt in viele Einzelfacetten.
Hinzu kommt das veränderte Freizeitverhalten – die Abkehr von der lang geplanten gemeinsamen Unternehmung, eben vom Gruppen-Wandern, und die Hinwendung zum schnell per Internet oder Smartphone eingefädelten individuellen Spontanentscheid. Oft verbindet sich damit der Schritt zur Erlebnis- und Eventkultur, bei der es nur noch Konsumenten gibt.
So ist denn auch die Landschaft für viele nichts mehr, wofür man Verantwortung übernehmen, was man gemeinsam pflegen muss. Für einen wachsenden Teil unserer Zeitgenossen ist die Natur längst kein Bild mehr für Harmonie und Schönheit der Schöpfung, sondern nur noch eine Ressource, die man eben nutzt. Die modernen Trendsportarten degradieren die Landschaft gar zum bloßen Sportgerät: Beim Gleitschirmfliegen zum Beispiel – neudeutsch: Paragliding – verliert der Albtrauf seinen Zauber. Man bedient sich des Steilabfalls nur noch, weil man von dort, indem gegebenenfalls noch ein paar Bäume niedergemacht werden, gut starten kann und Thermik hat. Noch drastischer beim Mountainbiking – ohnedies ein paranoider Unsinn, weil man hier genau dort Fahrrad fährt, wo es jeder Vernunft widerspricht. Es ist das sportliche „Trotzdem“. In bewusster Opposition zur Natur sucht man Extremrouten über Stock und Stein, die eigentlich nicht befahrbar sind, oder man funktioniert Wanderwege um und ruiniert sie. Beim Free Climbing richtet man den Tunnelblick auf die Felsen im Donautal ohne Rücksicht auf Verluste. River Rafting erledigt sich bei uns zum Glück von selbst, weil – der Wasserarmut sei Dank – die Flüsse sind nicht reißend genug sind. Dafür wird der Bodensee von PS-starken Motorbootrasern heimgesucht – verheerend, auch wenn sie 300 Meter vom Ufer entfernt blieben müssen. Und endlich noch das Letzte: Geocaching – Schnitzeljagd mit GPS und querfeldein-Spielchen mit digitaler Technik. Ein Verzicht auf jedes natürliche Orientierungsvermögen, eine Schmuseaffäre mit der digitalen Demenz nach der Devise: Ich weiß nicht wohin, aber mein Navi sagt mir, wo es lang geht. Als ob wir nicht schon desorientiert genug wären. Und dann trampelt man kreuz und quer die Natur nieder, nur um irgendeine versteckte oder versenkte Box mit einem Unsinnsinhalt zu finden.
All das macht es dem Albverein nicht leichter. Auch der „Wildwuchs“ der Wanderwege durch Aktionen einzelner Gemeinden und Initiativen von Tourismusverbänden, oft in verwirrender Überlagerung des seit 125 Jahren bewährten Albvereins-Wegesystems, entspricht nicht den Intentionen des Vereins, zumal die neuen Wege häufig ohne jede Nachhaltigkeit angelegt sind.
Endlich noch ein Kapitel für sich: die Schule – konkret das Verkommen der Wandertage. Früher war klar: Ein Wandertag bedeutet Ausflug mit Wandern. Eine wichtige Erfahrung. Natürlich haben auch schon wir früher als Schüler die Devise verbreitet: kleine Wanderung, große Wirtschaft. Zum Glück war es dann meistens umgekehrt. Aber heute wird aufs Wandern häufig ganz verzichtet. Wandern ist uncool. Cool ist eine Busreise mit Komplettangebot, am besten in einen Freizeitpark. Mit anderen Worten: Was für die Senioren die Kaffeefahrt, das ist heute für viele Schüler der Wandertag. Man wird herumkutschiert und lässt sich irgendetwas bieten. Das ist die moderne Erlebnisgesellschaft, wie sie Gerhard Schulze beschrieben hat.
Ich bleibe noch bei der Schule. Früher gab es ein Fach, das hieß „Heimatkunde“. Dort haben wir viel gelernt. Nach 1968 wurde Heimat verdächtig, also hieß das Fach dann „Sachkunde“. Das war aber bald auch nicht mehr systemkonform. Darum heißt es heute „MENUK“ – Mensch, Natur, Umwelt, Kultur. Ein vernünftiger Ansatz zwar, aber eine völlig umnachtete Abkürzung, an den Albverein so jedenfalls schwer anschlussfähig.
Schließlich diejenigen, die Schule gestalten: die Lehrer. Ich war früher selber einer, der Herr Ministerpräsident auch. Und um es gleich vorweg zu sagen: Die allermeisten Lehrer leben für ihren Beruf und leisten weit mehr als sie müssten. Aber es gibt auch Wahrnehmungen von Schule, die zu denken geben. Ein Beispiel meiner Tochter aus der Grundschule, Klasse 3: Eine Stunde muss vertreten werden. Es kommt ein Lehrer und spielt mit den Schülern „Stadt – Land – Fluss“. Irgendwann wird der Buchstabe B gezogen. Stadt, kein Problem: Berlin. Land, auch einfach: Belgien. Mit Flüssen allerdings wird es bei B ein bisschen eng. Meine Tochter überlegt, schließlich schreibt sie: „Blau“. Bei der Ergebniskontrolle sagt der Lehrer: „Blau gibt’s nicht, das ist kein Fluss.“ Meine Tochter insistiert, die Blau gebe es wirklich. Zufällig klopft da gerade ein zweiter Lehrer an der Tür, um den Vertretungsplan weiter zu organisieren. Der rätselnde Kollege fragt auch ihn, ob es einen Fluss namens Blau gebe. „Nein,“ sagt der andere, „gibt’s nicht“. Er ist übrigens evangelischer Theologe, aber offenbar ohne jede Ahnung von Blaubeuren und seinem evangelischen Seminar, geschweige denn vom Blautopf oder gar seiner literarischen Verarbeitung durch Eduard Mörike. Zwei Pädagogen: ein Duett dumpfer Unwissenheit. Aber es geht noch weiter: Statt vielleicht doch mal nachzusehen, eventuell per Smartphone, wie sich das mit einem Gewässer namens Blau verhält, kommt just vom Theologen die Frage an meine Tochter: „Wer behauptet denn, dass Blau ein Fluss sei?“ Antwort: „Mein Papa“. Darauf der Lehrer: „So, und bist du Dir da ganz sicher, dass Dein Papa nicht lügt?“ Da ballen sich fachliche Souveränität, pädagogisches Geschick und Sozialkompetenz. Also: Der „Lehrer light“, wie er von der momentanen Schulpolitik angestrebt wird, braucht gar nicht erst geschaffen zu werden. Einige Prototypen davon gibt es schon. Und wenn die in Serie gehen – dann Gnade uns Gott. Es wäre also sicher nicht von Nachteil, wenn auch in der künftigen Lehrerbildung erst einmal solide wissenschaftliche Grundlagen geschaffen würden und diese nicht der Zeitvergeudung mit irgendwelchen pädagogischen Pirouetten zum Opfer fielen.
Dass der Albverein hier seinerseits den Kontakt mit den Schulen sucht, dass er sich auch sonst öffentlich zu Wort meldet, wo es ihm nötig scheint, ist gut. Er hat Erfahrung in der Vermittlung von Heimat und der Schaffung von Identität; denn Heimat und Identität sind heute wichtiger denn je. Seine Stimme dürfte der Verein übrigens ruhig auch mal in Richtung Fernsehen erheben. Da wurden zur Vermittlung von Heimat durchaus gute Formate entwickelt wie etwa „Fahr mal hin“. Im Jugendwahn der Quotenmedien entstand aber auch für den Freitagabend die Erkundungssendung „Hin @ weg“. Jawohl „hin“, digitaler Klammeraffe „@“ und „weg“. Zum Glück ist das Experiment inzwischen Geschichte. Heute heißt das Format: „Expedition in die Heimat“ – Expeditionen muss man inzwischen also machen, um in die Heimat zu kommen. Der Heimatbegriff der Medien ist ohnedies „very spezial“. Vor Jahren schon gab es eine Klausurtagung hochkarätiger programmverantwortlicher Fernsehleute im Schwarzwald zum Thema „Heimat“. Am Ende wurde dann die Formel geboren: „Heimat ist Nähe“. Das muss erst mal gesagt werden. Und dazu dann noch der flotte Taxifahrer-Spruch im Werbespot für SWR 3 „Wo du wolle?“ In die Heimat vermutlich.
Auch hier braucht man Gegengewichte: Oasen der Vernunft in der Wüste des Schwachsinns. Der Albverein – mit allem Respekt – ist eine solche Oase. Und er ist auf die Zukunft gut vorbereitet. Alle wichtigen Zukunftsthemen sind, weit über den Tag hinausblickend, im Schlusskapitel der sehr schönen Festschrift bereits angesprochen. Auch an sich selbst stellt der Verein dort kritische Fragen – bis hin zu der öffentlichen Überlegung, ob man Gebietseinteilungen in Gaue oder Ämterbezeichnungen, die mit -wart enden, künftig nicht doch modernisieren solle. Ein alter Verein mit jugendlicher Dynamik.
Eben dies ist das Bewundernswerte am Schwäbischen Albverein: Sein ungebrochener Elan, auch nach 125 Jahren. Er bleibt sich treu, indem er Bewährtes weiterführt; und er geht mit der Zeit, indem er sich den Herausforderungen der Gegenwart stellt. Er reagiert nicht nur, sondern agiert. Er nimmt seine Verantwortung für Mensch, Natur und Umwelt wahr, die er übernommen hat – für einen geographischen Raum, der weit über die Schwäbische Alb hinausgreift. Und er schaltet sich in Diskurse ein, auch in schwierige Kontroversen wie etwa den kaum befriedigend zu lösenden Konflikt um regenerative Energien einerseits und Windkraftanlagen andererseits.
Es ist ein enormes Spektrum an Formen des Engagements: Vom Wandern über den Natur- und Denkmalschutz und die gemeinsam mit dem Schwarzwaldverein betriebene, höchst anspruchsvolle Wanderakademie bis hin zur Kultur, zum Schwäbischen Kulturarchiv, zu Volkstanz, Mundart, Musik und Gesang – ein Bereich, um den sich Manfred Stingel hoch verdient gemacht hat. Gerne kann ich hier, wenn gewünscht, auch selber als Kulturwissenschaftler einmal etwas zur Vereinsarbeit beitragen. Denn gerade Kultur ist mehr als nur das Schöne von einst, das man vom Gestern ins Heute retten muss. Kultur ist das Heute, das es unter Einbeziehung des Gestern fürs Morgen fit zu machen gilt.
Die allergrößte Herausforderung für den Albverein und für uns alle aber wird zweifellos der demographische Wandel sein – in der Festschrift übrigens auch schon deutlich thematisiert. Unsere Gesellschaft wird älter und vor allem bunter. Schon heute haben rund 25 Prozent der Einwohner Baden-Württembergs einen Migrationshintergrund. Immer mehr Menschen bringen in ihrem Gepäck einen anderen kulturellen Baukasten mit als wir ihn haben. Und immer mehr Menschen werden künftig in zwei Kulturen gleichzeitig leben – Transkulturalität nennt man das. Dies muss für uns aber überhaupt kein Verlust, dies kann und wird auf Dauer sogar eine Bereicherung sein. Schon immer haben wir, hat auch die Alb vom Fremden und von den Fremden profitiert. Anregungen aus der Fremde haben schon vor Generationen unsere Trachten so bunt gemacht, unsere Bräuche so farbenfroh gestaltet, kurz: unser Leben interessanter gemacht. Nehmen wir einfach nur mal als Beispiel Italien. Was wäre Oberschwaben ohne die italienischen Architekten und Künstler des Barock? Wie stünde es um unsere Heizungen, wenn nicht Kaminkehrer aus dem Aostatal ihre Erfahrungen hierher transferiert hätten? Was täten wir heute ohne die beliebten Italoschwaben mit ihren Pizzerien und Eisdielen. Ja nicht einmal unsere Spätzle hätten wir ohne die Italiener, denn Spätzle kommt vom italienischen „Spezzetto“ und bedeutet: Kleingeschnittenes. Die Reihe ließe sich mit anderen Ländern fortsetzen – bis hin zur Türkei, ohne deren Einfluss zum Beispiel unsere Musikkapellen heute ganz anders klingen würden.
Wichtig ist, dass alle hier Heimat finden. Und genau da engagiert sich der Albverein enorm. Denn Heimat ist nicht und war niemals engstirnige Kirchturmpolitik. Sondern Heimat korrespondiert seit eh und ja mit der Fremde, Heimat war schon immer der Komplementärbegriff zu Welt. Nur wer die Heimat kennt, hat eine Chance, die Welt zu verstehen. Und das Gleiche gilt auch umgekehrt: Nur wer etwas von der Welt weiß, kann die Heimat schätzen. Mit anderen Worten: Um daheim anzukommen, muss man erst fort gewesen sein. Scheinbar eine Binsenweisheit, in Wirklichkeit aber Philosophie.
Und noch etwas: Heimat ist kein statischer Begriff. Heimat ist – genau wie einmal auch die Schwäbische Alb – zuallererst ein Konstrukt in unseren Köpfen. Jeder hat eine andere Vorstellung davon. Ein einfacher Versuch könnte das zu zeigen: Wenn von hundert Menschen jeder eine Landkarte vorgelegt bekäme mit der Bitte, er solle dort einkreise, was für ihn geographisch Heimat ist, so käme eine Fülle ganz verschiedener Kreise heraus. Vermutlich gäbe es so gut wie keine Kongruenzen, jede Umgrenzung sähe anders aus. Heimat ist also etwas ganz Individuelles, nichts Generalisierbares. Aber gerade daran, dass sie nicht objektiv existiert, sondern subjektiv erarbeitet werden muss, zeigt sich, dass sie formbar, gestaltbar ist, durch jeden einzelnen von uns. Und genau diese Chance müssen wir nutzen.
Jeder kann hier etwas tun, jeder kann seine Nahwelt, die nicht nur ein Ort oder ein Raum ist, sondern auch eine Gemeinschaft von Menschen, so gestalten, dass andere sich darin geborgen fühlen, dass sie sich beheimaten können. An diesem unaufhörlichen Prozess, der niemals zu Ende kommen wird, wirkt der Schwäbische Albverein seit seiner Gründung in vorbildlicher Weise mit. Dieses Ziel hat er nie aufgegeben, darum geht es ihm, den Problemen der jeweiligen Zeit entsprechend, auch heute und morgen. Was der Schwäbische Albverein tut, ist im besten Sinne das, was Ernst Bloch in seinem „Prinzip Hoffnung“ meint, wenn er vom „Umbau der Welt zur Heimat“ spricht.
Und zu diesem ehrgeizigen Unterfangen, dem Umbau der Welt zur Heimat, wünsche ich dem Schwäbischen Albverein für das nächste Vierteljahrhundert seiner Geschichte und natürlich noch weit darüber hinaus alles Gute und den gewohnten Erfolg.